
Wie werden Offshore-Windparks vor Anschlägen geschützt?

Spätestens seit dem 26. September 2022 ist klar: Deutschlands Energie-Infrastruktur ist verwundbar. An diesem Tag ereigneten sich mehrere Explosionen an den Tiefseepipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee. Das hat die Erdgasversorgung des Landes stark eingeschränkt. Bis heute ist nicht vollständig aufgeklärt, wer für die gezielten Anschläge verantwortlich ist.
In der Ostsee – ebenso wie in der Nordsee – schreitet derzeit der Ausbau einer anderen Energie-Infrastruktur voran: die Offshore-Windenergie. Riesige Windparks entstehen mitten in den nördlich von Deutschland gelegenen Meeren. Ende 2023 lag die installierte Leistung aller 1.566 in Betrieb befindlichen Offshore-Windkraftanlagen bei rund 8,5 Gigawatt (GW).
Bis 2030 sollen es bereits 30 GW sein. Auch wenn die installierte Leistung nichts über die tatsächliche Stromerzeugung aussagt – bei Windstille liefern auch 100 GW Windkraft keinen Strom –, haben diese Anlagen bestenfalls einen nicht zu vernachlässigen Anteil an unserer Stromversorgung. So liegt die sogenannte Grundlast in Deutschland derzeit bei 40 bis 65 GW. Weht der Wind ausreichend stark, können diese maritimen Kraftwerke rechnerisch etwa die Hälfte Deutschlands mit Strom versorgen. Wie sieht es aber mit ihrer Sicherheit aus?
Windparks in einem empfindlichen Gleichgewicht
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die deutsche Offshore-Energieversorgung in der Zukunft ins Visier von Attentätern gerät. Die Folgen könnten dann für das Land fatal sein.
Denn anders als bei der Gasversorgung können die Stromnetzbetreiber bei plötzlichem Abfall in der Zufuhr nicht auf ausreichend gefüllte Speicher zurückgreifen. Das deutsche Stromnetz ist sensibel. Stromproduktion und -verbrauch müssen sich die Waage halten – sekundengenau. Wenn plötzlich mehrere Gigawatt an Leistung wegfallen, kann das die Netzstabilität vor Herausforderungen stellen.
Die Netzbetreiber müssen stets dafür sorgen, dass sich die Netzfrequenz bei 50,0 Hertz befindet. Wenn unvorhergesehen plötzlich eine größere Kraftwerksleistung wegfällt, sinkt auch die Netzfrequenz.
Bereits bei 49,8 Hz müssen Maßnahmen ergriffen werden. Sinkt der Wert weiter ab, besteht die Gefahr eines größeren Stromausfalls. Das Gleiche gilt analog, wenn plötzlich Verbraucher wegfallen und „zu viel“ Strom im Netz ist, der die Netzfrequenz ansteigen lässt.

Ein TenneT-Umspannwerk in Schleswig-Holstein. Foto: Bjoern Wylezich/iStock
Kaskadenartige Ausfälle möglich
Ein solcher Angriff auf die Energie-Infrastruktur kann dabei gesellschaftlichen Schaden anrichten. Im Falle eines Cyberangriffs kann es aus Sicht der in Brüssel ansässigen Organisation WindEurope beispielsweise zu einer Betriebsunterbrechung, zu Datenpannen oder physischen Schäden kommen.
Das löse unter Umständen Stromausfälle aus. „Was die Blackout-Szenarien betrifft, so könnten sie auf lokaler Ebene stattfinden, sofern der Angriff auf den Windpark beschränkt ist“, erklärte die Pressesprecherin Clara Castelli auf Anfrage der Epoch Times. Ein lokal begrenzter Stromausfall wäre dann möglich, der das unmittelbare Gebiet betrifft, das von der Energieerzeugung des Windparks abhängig ist.
Je nachdem, wo der Strom der Offshore-Windkraftanlagen gerade hinfließt, könnten dann auch die südlichen Bundesländer in Mittel- oder Süddeutschland betroffen sein. Bereits heute gibt es bei guten Windverhältnissen oftmals „zu viel“ Strom. Kann dieser mangels Leitungskapazitäten nicht zu den Verbrauchern im Süden transportiert werden, fließt er ins Ausland. Reicht auch das nicht, werden Windkraftanlagen abgeregelt.
Die Netzbetreiber arbeiten aber bereits daran, die Leitungskapazitäten zu erhöhen. So soll der nordische Windstrom den Höchstspannungsleitungen SuedLink und SuedOstLink dann zuverlässig bis nach Bayern fließen.
Weiter sagte Castelli: „Wenn der Angriff das übergeordnete Netz beeinträchtigt, könnte er zu einer Destabilisierung des regionalen Netzes führen und damit möglicherweise einen größeren Stromausfall verursachen.“ Im schlimmsten Fall könne es „zu kaskadenartigen Ausfällen in zusammengeschalteten Stromnetzen“ kommen.
Da die europäischen Länder ein gemeinsames Verbundnetz haben, könnte sich ein Stromausfall auf mehrere Länder ausdehnen. Das schloss Castelli nicht aus. „Mit der kommunikativen Abschaltung [durch die Netzbetreiber] kann man möglicherweise schlimmere Auswirkungen verhindern.“
Wer ist verantwortlich?
Um herauszufinden, wie es um die momentane Sicherheitslage steht, hat die Epoch Times bei zuständigen Behörden nachgefragt. Da ein Anschlag auf die Energie-Infrastruktur einen möglicherweise kriegerischen Akt darstellen könnte, war die erste Anlaufstelle das Bundesministerium der Verteidigung (BMVG).
„Grundsätzlich ist die Bundeswehr für den militärischen Schutz der Souveränität Deutschlands zu Land, See und Luft und somit unserer Bevölkerung vor militärischer Bedrohung zuständig.“ Das teilte eine Sprecherin des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr mit. Die deutschen Streitkräfte würden also auch die sogenannten „verteidigungswichtigen Infrastrukturen“ schützen. Für Details verwies die Sprecherin auf das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI).
Ein Sprecher des BMI bestätigte, dass Offshore-Windkraftanlagen mit den angebundenen Seeleitungen zu den kritischen Infrastruktureinrichtungen gehören. Ebenso wies er darauf hin, dass diese Kraftwerksstruktur „mit Blick auf die aktuelle Sicherheitslage einer abstrakten Gefährdung unterliegt“. Mit abstrakter oder latenter Gefahr ist eine Gefahr gemeint, die nicht konkret droht. Nichtsdestotrotz seien Schutzmaßnahmen nötig.
Doch auch das BMI sieht sich nicht in der vollen Zuständigkeit beim Schutz dieser „kritischen Infrastruktur“. Nach Aussage des Sprechers sei dies zunächst die Aufgabe der Betreiber der Offshore-Windparks in der Nordsee. „Zugleich handelt es sich aber um eine gesamtstaatliche Aufgabe des Bundes und der Länder in Abstimmung mit den Betreibern“, so der BMI-Sprecher.
Er betonte die intensivierte nationale und internationale Zusammenarbeit durch die Behörden des Bundes und der Länder. Auch die Bundespolizei sei in der Nord- und Ostsee präsent. Bei möglichen Gefahrensituationen könne diese mit Hubschraubern und Schiffen eingreifen. „Sie ist darauf vorbereitet, diese Fähigkeiten bei verschiedenen Gefahrenszenarien lageangepasst und schnell zum Einsatz zu bringen“, erklärte der BMI-Sprecher.
Zu detaillierten Fragen wollte sich das BMI „aus Sicherheitsgründen nicht äußern“.
Was sagen die Betreiber?
Das Unternehmen Ørsted hat nach eigenen Angaben in der Nordsee bereits vier große Windparks in Betrieb. Zwei weitere befinden sich derzeit im Bau. Eine Möglichkeit eines Angriffs auf die Windkraftanlagen ist die gezielte Kollision mit einem Windrad. Laut dem Pressesprecher Steffen Kück sind die Offshore-Windkraftanlagen deutlich räumlich getrennt von den Schiffsrouten.

Schiffe könnten Offshore-Windkraftanlagen bei ungünstigen Bedingungen gefährlich nahekommen. Foto: balipadma/iStock
„Dennoch müssen Betreiber im Rahmen ihres Genehmigungsverfahrens für Offshore-Windenergieanlagen und andere Offshore-Strukturen regelmäßig eine Kollisionsanalyse durchführen“, teilte Kück mit. „In dieser Kollisionsanalyse müssen wir unter anderem nachweisen, dass die Standsicherheit der Anlage im Falle einer Schiffskollision erhalten bleibt.“ Ebenso müsse die Analyse eine Auslegung aufzeigen, womit die Schiffe möglichst unbeschädigt bleiben, um Gefahren für Menschen und Meeresumwelt zu minimieren.
Ob die Standsicherheit bei einer Schiffskollision tatsächlich ausreichend ist, ist angesichts des Ereignisses von Baltimore im März dieses Jahres fraglich. Ein Frachter rammte den Pfeiler einer Verkehrsbrücke und brachte diese zum Einsturz.
Der Energiekonzern RWE hielt sich anlässlich der Anfrage der Epoch Times weitestgehend zurück. Von der Presseabteilung hieß es lediglich: „Die Sicherheit und der Schutz unserer Offshore-Windparks genießt oberste Priorität.“
Öffentliche Informationen, vielfältige Angriffsmöglichkeiten
Bezogen auf den Schutz kritischer Offshore-Energieinfrastrukturen wies Castelli auf die „vielen Herausforderungen“ hin. „Es handelt sich um ein komplexes System, das nicht reguliert ist – weder auf internationaler noch auf nationaler Ebene.“ Ebenso seien daran verschiedene Interessengruppen beteiligt, die Infrastrukturen hätten verschiedene Eigentümer, darunter auch private Parteien.
Physische Angriffe könnten laut Castelli „leicht von der Oberfläche, aus der Luft oder von Unterseebooten aus durchgeführt“ werden. Das ginge auf relativ günstigem Weg und mit begrenzten technischen Möglichkeiten. Hier kämen beispielsweise Explosionen, Ausbaggern oder auch der Absturz eines Flugzeugs in einen Windpark infrage.
„Die Standorte der Leitungen sind öffentlich zugänglich“, schilderte die Pressesprecherin. So könnten Angriffe von einfachen Schiffen aus umgesetzt werden. Der Balticconnector-Zwischenfall im Oktober 2023 sei ein Beispiel hierfür. Dabei handelt es sich um eine Beschädigung an einer Unterwassergaspipeline zwischen Estland und Finnland, die wahrscheinlich durch eine äußere Einwirkung zustande kam. Ob absichtlich oder nicht, ist offen. Unter Umständen kann bereits ein treibender Anker eine Unterseeleitung beschädigen.
Auch auf digitalem Weg sieht der Branchenverband WindEurope, der die Windenergie in Europa fördert, eine Angriffsmöglichkeit. „Cyberangriffe können aufgrund der Vernetzung und gegenseitigen Abhängigkeit der Offshore-Infrastruktur zu systemweiten Ausfällen führen“, erklärte Castelli. Beispiele hierfür seien die Angriffe auf das ukrainische Stromnetz in den Jahren 2015 und 2016 und der Angriff auf die US-Pipeline Colonial im Jahr 2021. Darüber hinaus sorgte eine Satellitenstörung vor gut zwei Jahren dafür, dass Tausende Windräder zeitweise nicht ansteuerbar waren.
Eine weitere Bedrohung seien hybride Angriffe. Darunter sind zweischichtige Angriffe zu verstehen, bei denen die Unterscheidung zwischen absichtlichen Angriffen und unabsichtlichen Unfällen verwischt wird – etwa ein Fischerboot, das ein Kabel beschädigt. In der Regel handele es sich hierbei um staatlich unterstützte Angriffe. Als „das beste Beispiel“ nannte Castelli hier die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines. „Diese Angriffe erfolgen in der Regel durch die Manipulation automatischer Erkennungssysteme, mit denen die Behörden Schiffe auf See verfolgen können.“
Kompetenzwirrwarr statt klarer Ansagen
Auf internationaler Ebene regelt das UN-Seerechtsübereinkommen UNCLOS den Meeresraum und seine Nutzung, erklärte Castelli weiter. Es gelte allerdings nur für Seefahrzeuge mit Besatzung, also nicht für unbemannte Fahrzeuge wie Drohnen. Außerhalb der Hoheitsgewässer seien die Staaten zudem nicht förmlich verpflichtet, Stromleitungen und Pipelines zu schützen. Hoheitsgewässer reichen bis 12 Seemeilen (rund 22,2 Kilometer) vor die Küste. Windparks stehen oft in der „ausschließlichen Wirtschaftszone“ (AWZ), die 200 Seemeilen weit ins Meer reicht.
Wie Castelli schilderte, müssen die Behörden auf nationaler Ebene – also in der AWZ und den Hoheitsgewässern – Patrouillen durchführen können und auf physische und hybride Bedrohungen reagieren. „Bei den Zuständigkeiten wird zwischen Hoheitsgewässern, AWZ und Hoher See sowie zwischen einem Unfall auf fest verankerter Infrastruktur und einer Bedrohung durch ein Schiff, das in einen Windpark driftet, unterschieden.“
Allerdings herrschen hier nach Ansicht des Branchenverbands ein „Kompetenzwirrwarr, überschneidende Zuständigkeiten und lange Meldeketten“. Diese seien jedoch mit so vielen Akteuren unvermeidlich. „Die Zuständigkeit variiert von Land zu Land, von der Polizei bis zur Marine, und ist für die Windparkbesitzer sehr unklar“, meinte die Pressesprecherin. Allein in Deutschland gebe es die Küstenwache des Bundes, die Wasserschutzpolizeibehörden der Länder, das Maritime Sicherheitszentrum des Bundes und der Küstenländer sowie die Marine.

Schleswig-holsteinisches Küstenpatrouillenboot bei Helgoland. Foto: Bjoern Wylezich/iStock
Eine große Sicherheitslücke bestehe insbesondere bei hybriden Bedrohungen. Die Zuständigkeit könne am ehesten unklar sein, wenn die Bedrohung oder der Angriff nicht eindeutig einem Akteur zuzuordnen ist. Oder wenn unklar ist, ob es sich um einen Angriff oder einen Unfall handelt.
Entgegen der bisherigen Aussage der unternehmerischen Verantwortlichkeit sprach sich Castelli im Fall von eindeutig feindlichen Angriffen für ein Gewaltmonopol des Staates aus. Der Schutz der kritischen Infrastruktur des Staates vor Angriffen solle daher nicht Aufgabe eines Unternehmens wie des Betreibers eines Windparks sein.
Überwachung der Gewässer
Zu den bewährten präventiven Schutzmaßnahmen zählt laut Castelli der Einsatz unbemannter Wasserfahrzeuge, autonome Unterwasserfahrzeuge und unbemannte Luftfahrtsysteme für Überwachungs- und Patrouillenmissionen. Es ist davon auszugehen, dass all diese Fahrzeuge eine Datenverbindung haben, um mit der Basisstation kommunizieren zu können. Das stellt seinerseits eine potenzielle Sicherheitslücke dar.
Als weitere Lösungen gelten der Einsatz von Radar und Kameras zur Beobachtung von Schiffen sowie Sensoren in Stromkabeln, um ungewöhnliche Bewegungen zu erkennen. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass Windkraftturbinen die Signale von Radaranlagen verändern und verfälschen können. Zudem kostet die Installation einer solchen Ausrüstung in einem großen Windpark laut „Reuters“ zwischen 20 und 60 Millionen Euro. Das entspricht zwei Prozent der Kosten eines Offshore-Windparks. Eine Überwachung einschließlich aktiver Patrouillen würde die Kosten weiter erhöhen.
Castelli weist darauf hin, dass verschiedene technologische Innovationen zusätzliche Möglichkeiten bieten. So gebe es „Robotik, ausgestattet mit empfindlichen Kameras, Sonaren, Magnetometern und KI-Algorithmen, die eine längere Unterwasserüberwachung ermöglichen“. Die Regierungen, die Offshore-Windindustrie und die Übertragungsnetzbetreiber sind hieran beteiligt, sagte die Pressesprecherin.
Zusammenarbeit mit der NATO
Um den Schutz der Offshore-Windparks zu intensivieren, arbeitet WindEurope seit 2020 mit der NATO zusammen, wie Castelli mitteilte. Sie wies in diesem Zusammenhang auf eine Übung zum Schutz kritischer maritimer Energieinfrastrukturen vor hybriden Bedrohungen hin, die im November 2023 in Riga organisiert wurde. „Alle wichtigen Behörden aus den Ostseeanrainerstaaten und darüber hinaus waren anwesend, darunter auch einige unserer Mitglieder wie Orlen und Equinor.“
Mit der Offshore-Windbranche, der NATO, verschiedenen Ministerien und Institutionen verfolgt WindEurope nach eigenen Angaben derzeit folgende Punkte:
- Die Sicherheit von Windkraftanlagen und ihre Nutzung als Plattform für die Landesverteidigung.
- Anforderungen an vorgeschlagene Erweiterungen von Windparks zur Unterstützung von Verteidigungsinteressen.
- Erörterung der Verantwortlichkeiten für den Schutz von Windparks durch Entwickler, Eigentümer, Regierungen und Verteidigungsbehörden.
- Festlegung der Lösungen, die Entwickler verwenden dürfen, und der rechtlichen Grundlagen innerhalb von Hoheitsgewässern, wirtschaftlichen Sperrzonen usw.
- Bewertung der Angleichung zwischen den Mitgliedstaaten in diesen Fragen.
- Untersuchung von Strategien zur Vermeidung des Eindrucks, dass die Offshore-Umgebung militarisiert werden soll, indem Offshore-Windparks als Plattform genutzt werden.































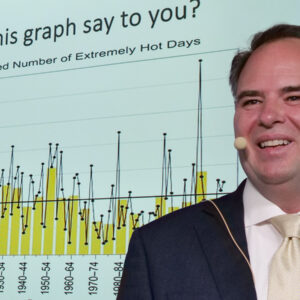







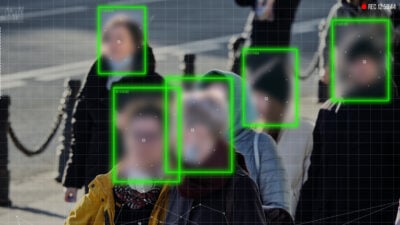


vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion