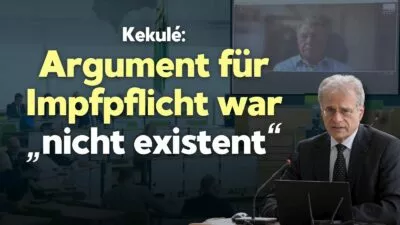Genomsequenzierung für alle Babys bei Geburt?
Ein britisches Unternehmen plant, die vorsorgliche Genomsequenzierung von 200.000 Babys. Neben möglichen Frühdiagnosen erhält man damit Unmengen höchst persönlicher Daten von Personen, die noch nicht einmal zustimmen können.

Genomsequenzierung bei Geburt ermöglicht Früherkennung einiger Krankheiten – und Missbrauch der Daten (Symbolbild).
Foto: iStock
Dieser Frage gingen vier Autoren um Dr. Eric Green, Direktor des Nationalen Genom-Forschungsinstituts (NHGRI) in Maryland (USA), im „British Medical Journal“ nach. Ihre Ergebnisse veröffentlichten Sie Mitte November ebendort. Ihre Antwort ist alles andere als einstimmig, wobei nicht nur ethische, medizinische und finanzielle Aspekte unterschiedliche Schlussfolgerungen zulassen.
Genomdaten in einem „leicht zugänglichen System speichern“
Umfangreiche klinische Nachweise haben gezeigt, dass das Screening auf genetische Krankheiten Leben rettet. Die Forschung habe auch gezeigt, dass es kosteneffizient sein kann, erklären Dr. Green und Kollegen unter Berufung auf eine Studie aus dem Jahr 2015.
Eine routinemäßige Genomsequenzierung bei Neugeborenen werde es irgendwann geben, so die Autoren weiter. Doch anstatt Neugeborene auf alle Krankheiten zu untersuchen, plädieren sie für eine schrittweise Einführung. Bei der die „Genomsequenz [zur] Geburt erstellt wird und im Laufe der Zeit genomische Varianten nacheinander bei Neugeborenen, Kindern, Jugendlichen im reproduktiven Alter und bei Erwachsenen offengelegt werden“, um bestimmte Erkrankungen „in einem Lebensstadium offenzulegen, in dem Interventionen bekanntermaßen von Nutzen sind.“
Eine solche Einführung genomischer Informationen solle zudem von Aufsichtsgremien begleitet werden, sowie „mit informierter Zustimmung und angemessenen Ausstiegsoptionen“ einhergehen. Außerdem sollten die Daten in einem „mit der Krankenakte verknüpften Datenspeicher gespeichert werden, der für die Leistungserbringer im Gesundheitswesen leicht zugänglich ist und für Reanalysen zur Verfügung steht, um mit dem wachsenden Wissen Schritt zu halten“.
Genomsequenzierung soll Leben retten
Um den erwarteten Nutzen der routinemäßigen Sequenzierung des Genoms von Neugeborenen zu erzielen, sind laut Dr. Green et al. Fortschritte in verschiedenen Bereichen erforderlich. Die Datenqualität, ein angemessenes Informationsmanagement und Systeme zur Unterstützung klinischer Entscheidungen seien nur einige.
Die Forderung, dass alle medizinischen Fachkräfte, die keine Genetiker sind, umfassend in Genetik und Genomik geschult werden sollten, lehnen sie jedoch als „unpraktisch und unnötig“ ab.
Nur durch die Sequenzierung des gesamten Genoms einer Person in einem frühen Stadium des Lebens könne das volle Potenzial der Genomdiagnose ausgeschöpft werden. Dies biete die Möglichkeit, Diagnosen schneller und genauer zu stellen und gezielte und gentechnische Therapien mit minimaler Verzögerung am Krankenbett einzusetzen.
„Indem wir ein Gesundheitsökosystem schaffen, das allgemein verfügbare Routineuntersuchungen für Neugeborene anbietet, können wir den Lernprozess maximieren, um sicherzustellen, dass die Vorteile der Genomik die größtmögliche Zahl von Menschen erreichen, Ungleichheiten minimieren und allen mehr Gesundheit bringen“, so die Schlussfolgerung.
„Keine Rechtfertigung Gesundheitsprobleme ohne Zustimmung zu bewerten“
Dr. David Curtis, Honorar-Professor für Genetik am University College London, der ebenfalls zu den Ergebnissen im BMJ beigetragen hat, sieht es differenzierter. Er argumentiert, dass das Genom eines Menschen eine riesige Menge an persönlichen Daten ist und es keinen Grund gibt, diese routinemäßig von allen Bürgern zu erfassen, bevor sie alt genug sind, um eine informierte Zustimmung zu geben.
Er weist darauf hin, dass nur eine winzige Anzahl von genetischen Erkrankungen Maßnahmen erfordern, bevor eine Person in ein Screening einwilligen kann. Außerdem gebe es bereits Verfahren, um Neugeborene auf diese seltenen, aber schwerwiegenden Erkrankungen zu testen.
Die Genomsequenzierung kann auch Aufschluss über das Risiko geben, an vielen Krankheiten zu erkranken, für die es keine spezifischen Maßnahmen gibt, erklärt er. Aber selbst wenn einige Erwachsene daran interessiert sind, diese Risikoinformationen zu erhalten, „gibt es keine Rechtfertigung dafür, das Risiko künftiger Gesundheitsprobleme bei Neugeborenen ohne deren Zustimmung zu bewerten“.
Er führt Beispiele an, in denen die Sequenzierung des Genoms von Neugeborenen für die Gesellschaft von Nutzen sein könnte. Er fügte hinzu, dass dies „nicht als Rechtfertigung für die Sequenzierung der Genome von Babys dienen kann“.
Warum bei Babys, wenn Erwachsene nicht wollen?
Dr. Curtis gibt überdies zu bedenken, dass unsere persönlichsten Daten missbraucht werden könnten. In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass einige Regierungen Berichten zufolge eine massenhafte Sammlung von DNA durchführen, die für repressive Praktiken bis hin zur zwangsweisen Organentnahme verwendet werden könnte.
„Warum also sollten wir die Genomsequenzierung von Babys in Erwägung ziehen, die in dieser Angelegenheit kein Mitspracherecht haben, wenn wir uns als Gesellschaft nicht darauf geeinigt haben, dass alle Erwachsenen, bei denen die potenziellen gesundheitlichen Vorteile viel größer zu sein scheinen, diesem Verfahren unterzogen werden sollten?“, fragt er.
Er fordert daher, zunächst eine andere Frage zu beantworten: Sollten alle Erwachsenen ihr Genom sequenzieren lassen? Wenn die Antwort darauf – wie seine – „Nein“ laute, dann sollte man die medizinischen Tests an Neugeborenen auf die wenigen Krankheiten beschränken, bei denen man sich einig ist, dass die Tests einen echten Nutzen für sie bringen“ .
.
(Mit Material des British Medical Journals)
Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 21, vom 4. Dezember 2021.
Aktuelle Artikel des Autors
06. April 2025
Sport formt den Charakter und macht schlau
16. März 2025
Singen: Eine angeborene Fähigkeit, die gesund macht
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.