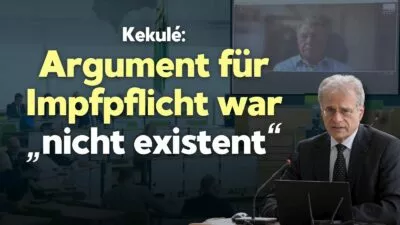Völlig verändert nach einer OP: Die wenig bekannte Nebenwirkung von Anästhesie
Das sogenannte postoperative Delir, eine vorübergehende Funktionsstörung des Gehirns, kann die Persönlichkeit der Betroffenen verändern, vor allem bei älteren Personen. Es gibt aber auch erste medizinische Erkenntnisse und Tipps, wie das Risiko dafür gesenkt werden kann.

Etwa jede zweite ältere Person hat ihn nach einer Operation: Einen Zustand der Verwirrtheit und Desorientierung.
Foto: gorodenkoff/iStock
Die unbekannte Volkskrankheit
Symptome eines Delirs
- Desorientierung: Die Betroffenen wissen nicht, wo sie sind und welcher Tag es ist. Manchmal erkennen sie ihre Angehörigen und Freunde nicht mehr.
- Körperliche Unruhe: Die Patienten sind sehr aktiv und unruhig. Manchmal versuchen sie, wichtige Infusionsschläuche oder Drainagen zu entfernen oder aus dem Bett zu steigen und wegzulaufen.
- Teilnahmslosigkeit: Die Betroffenen wirken depressiv, sind nicht ansprechbar und in sich gekehrt und wollen nicht aus dem Bett aufstehen.
- Angst und Wahnvorstellungen: Die Patienten sehen bedrohliche Gegenstände oder Gestalten.
- Gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus
- Alpträume
Risikofaktoren
- schlechte kognitive Fähigkeiten,
- Gebrechlichkeit,
- schlechte Ernährung,
- Alkoholmissbrauch,
- Depressionen und
- nicht erkannter Diabetes.
Risikofaktor Narkose
Vertraute Gegenstände und Gehirntraining senken das Delirrisiko
Aktuelle Artikel der Autorin
27. September 2024
Wunderbeere: So gesund ist unsere heimische Himbeere
26. September 2024
Putin nennt Voraussetzungen für einen Atomwaffeneinsatz Russlands
Kommentare
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
Nach einer Darm-OP hatte ich auch ein Delier bei einer späteren Operation hat der Arzt gesagt es hängt damit zusammen wenn man vorher eine Beruhigungstablette bekommt allerdings hatte ich auch vorher einiges an Opiaten und anderen Schmerzmittel bekommen wegen extremer Schmerzen inzwischen ist alles wieder okay aber es hat gedauert es war ein wirklich traumatisches Erlebnis bei der OP danach habe ich kein Beruhigungsmittel genommen und alles ging gut
Ich weiß ja nichts, hatte aber meine Erlebnisse mit Vollnarkosen. Zweimal in Deutschland, einmal wegen großer Bauch-OP, einmal wegen komplizierter OP nach Bein-Bruch. Bauch-OP wurde erstmal den ganzen Tag verschoben, vorher natürlich nichts essen. Das bekommt mir nicht, ich leide an Unterzucker, bekomme dann extrem Migräne, die sich auch über eine Vollnarkose hinweg hält. Morgens nach OP mit großer Übelkeit und totalem Schwächegefühl aufgewacht. Schwestern zerrten mich hoch, ich müsse aufstehen. Ich sagte, ich kann nicht, sie zerrten mich hoch. Dann trat ein Schmerz auf in der Herzgegend, als hätte ich einen hölzernen Mühlenflügel statt Herz und ich brach zusammen. Wachte im Bett wieder auf, sehr geschwächt und übel. In Krankenakte darüber kein Eintrag.
Dann Beinbruch im Kashmir. Schlimme Umstände wg Ausgangssperre. Totale Schmerzen, Schienbein, Wadenbein und Fußgelenk gebrochen. Vorbehandlung in Srinagar. Krankenzimmer mit zwanzig oder mehr Betten, unglaubliche Zustände. Aber freundliche und respektvolle Behandlung, gutes Erklären. Narkose absolut problemlos auch im Aufwachen. Zweite OP in Penjim Wochen später schon mit Verwachsungen. OP musste verschoben werden, aber es kam jemand und fragte mich, was ich essen wollte, es dauere ja noch einige Stunden. Sehr freundliche Behandlung - Hygiene? Oh je. Aber Schwestern lieb und fürsorglich. Narkose völlig problemlos, Aufwachen klar und hungrig. Das mit der Hygiene machte mir keine Probleme.
Dann OP Frankfurt. Schon vorher extrem Migräne wegen langer Wartezeit ohne Essen. Nach OP irrsinnig Kopfschmerzen und Übelkeit, Übergeben. Mein Mann kümmerte sich, sonst niemand. Nachts fürchterliche Schmerzen. Geklingelte Nachtschwester wurde wütend beim zweiten Mal und setzte mir Spritze in den Ischiasnerv des anderen Beins (davon habe ich heute noch Probleme zwanzig Jahre später). Ohne Krücken konnte ich nicht gehen, kroch viele Meter über den Flur zur Toilette, bis eine Mitpatientin eine Schwester anraunzte, ob sie nicht sähe, dass ich nicht laufen könne, sie solle mir doch wenigstens Krücken geben. Ich bat um vorzeitige Entlassung, weil ich mich im kleinen Zimmer und mit Ehemann besser versorgen konnte als im Krankenhaus. Wurde von Oberarzt deswegen regelrecht fertig gemacht. Durfte deshalb zur Nachbehandlung nicht mehr kommen. Das ist eben Deutschland. Nullachtfuffzig Behandlung und ganz bestimmt auch mit den Narkosen. Nicht individuell nach Alter, Geschlecht und Gewicht. Wer irgendwie kann, meide Krankenhäuser. Wahnsinnig teuer und absolut schrecklich zumindest für Kassenpatienten.
Ich muss noch hinzufügen: In Srinagar war es ein staatliches Krankenhaus. Ich wurde behandelt wie normale indische Bürger, d.h. die Behandlung zahlt der Staat. Medikamente muss man bezahlen, aber die Preise sind gedeckelt, das war nicht viel. Auch in Penjim hätte ich ein staatliches KH aufsuchen können, hätte aber zu lange Wartezeiten gehabt (Visum lief bald ab). Der Operateur war ein absoluter Spezialist. Ich könnte noch einiges erzählen über indische Ärzte und Zahnärzte, die ohne Apparatemedizin treffende Diagnosen stellen können und (speziell Zahnärzte) mir mit Problemen halfen, die man in Deutschland zuvor angeblich nur durch Ziehen etlicher Zähne und Ersatz hätte beheben können. Einiges hält jetzt noch - dreißig Jahre später. Fünf Sterne für indische Ärzte und Zahnärzte. Hier ist es ja inzwischen so, dass die Ärzte überhaupt keine Diagnosen mehr stellen, das müssen die Maschinen machen. Wenn die Maschine nichts aussagt, hat man allenfalls Psyche.
Im Frühjahr hatte ich auch so ein Erlebnis ich hatte Schmerzen in der Ischias Gegend und vier Diagnosen bis man endlich wusste dass ich eine Entzündung am Beckenkamm hatte inzwischen unterscheide ich zwischen Ärzten und Medizinern
Meine älteste Tochter ist Krankenschwester und hat mir schon vor Jahren erzählt, dass sie sich nur eine Vollnarkose geben lassen würde, wenn es wirklich gar nicht anders geht.
Meine Großmutter hat nach einer Operation damals einfach aufgehört zu essen - ohne medizinische Indikation.
Sie wurde dann künstlich ernährt und ist wenige Monate später verstorben.
Mein Vater hatte eine Vollnarkose für eine Biopsie (unnötigerweise) nach der er 3 Tage gebraucht hat, um wieder halbwegs orientiert zu sein. Er wurde dann - trotz negativer Biopsieergebnisse - als Lungenkrebs-Patient behandelt und operiert.
Es ist wirklich schrecklich, was die Medizin den Menschen inzwischen alles antut. Aus Angst, aus Unkenntnis oder auch aus Profitgier... Ich könnte inzwischen ein Buch darüber schreiben. Lebe selbst seit 4 Jahren (unbehandelt) mit diagnostiziertem bösartigen Krebs.
4
Kommentare
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
Nach einer Darm-OP hatte ich auch ein Delier bei einer späteren Operation hat der Arzt gesagt es hängt damit zusammen wenn man vorher eine Beruhigungstablette bekommt allerdings hatte ich auch vorher einiges an Opiaten und anderen Schmerzmittel bekommen wegen extremer Schmerzen inzwischen ist alles wieder okay aber es hat gedauert es war ein wirklich traumatisches Erlebnis bei der OP danach habe ich kein Beruhigungsmittel genommen und alles ging gut
Ich weiß ja nichts, hatte aber meine Erlebnisse mit Vollnarkosen. Zweimal in Deutschland, einmal wegen großer Bauch-OP, einmal wegen komplizierter OP nach Bein-Bruch. Bauch-OP wurde erstmal den ganzen Tag verschoben, vorher natürlich nichts essen. Das bekommt mir nicht, ich leide an Unterzucker, bekomme dann extrem Migräne, die sich auch über eine Vollnarkose hinweg hält. Morgens nach OP mit großer Übelkeit und totalem Schwächegefühl aufgewacht. Schwestern zerrten mich hoch, ich müsse aufstehen. Ich sagte, ich kann nicht, sie zerrten mich hoch. Dann trat ein Schmerz auf in der Herzgegend, als hätte ich einen hölzernen Mühlenflügel statt Herz und ich brach zusammen. Wachte im Bett wieder auf, sehr geschwächt und übel. In Krankenakte darüber kein Eintrag.
Dann Beinbruch im Kashmir. Schlimme Umstände wg Ausgangssperre. Totale Schmerzen, Schienbein, Wadenbein und Fußgelenk gebrochen. Vorbehandlung in Srinagar. Krankenzimmer mit zwanzig oder mehr Betten, unglaubliche Zustände. Aber freundliche und respektvolle Behandlung, gutes Erklären. Narkose absolut problemlos auch im Aufwachen. Zweite OP in Penjim Wochen später schon mit Verwachsungen. OP musste verschoben werden, aber es kam jemand und fragte mich, was ich essen wollte, es dauere ja noch einige Stunden. Sehr freundliche Behandlung - Hygiene? Oh je. Aber Schwestern lieb und fürsorglich. Narkose völlig problemlos, Aufwachen klar und hungrig. Das mit der Hygiene machte mir keine Probleme.
Dann OP Frankfurt. Schon vorher extrem Migräne wegen langer Wartezeit ohne Essen. Nach OP irrsinnig Kopfschmerzen und Übelkeit, Übergeben. Mein Mann kümmerte sich, sonst niemand. Nachts fürchterliche Schmerzen. Geklingelte Nachtschwester wurde wütend beim zweiten Mal und setzte mir Spritze in den Ischiasnerv des anderen Beins (davon habe ich heute noch Probleme zwanzig Jahre später). Ohne Krücken konnte ich nicht gehen, kroch viele Meter über den Flur zur Toilette, bis eine Mitpatientin eine Schwester anraunzte, ob sie nicht sähe, dass ich nicht laufen könne, sie solle mir doch wenigstens Krücken geben. Ich bat um vorzeitige Entlassung, weil ich mich im kleinen Zimmer und mit Ehemann besser versorgen konnte als im Krankenhaus. Wurde von Oberarzt deswegen regelrecht fertig gemacht. Durfte deshalb zur Nachbehandlung nicht mehr kommen. Das ist eben Deutschland. Nullachtfuffzig Behandlung und ganz bestimmt auch mit den Narkosen. Nicht individuell nach Alter, Geschlecht und Gewicht. Wer irgendwie kann, meide Krankenhäuser. Wahnsinnig teuer und absolut schrecklich zumindest für Kassenpatienten.
Ich muss noch hinzufügen: In Srinagar war es ein staatliches Krankenhaus. Ich wurde behandelt wie normale indische Bürger, d.h. die Behandlung zahlt der Staat. Medikamente muss man bezahlen, aber die Preise sind gedeckelt, das war nicht viel. Auch in Penjim hätte ich ein staatliches KH aufsuchen können, hätte aber zu lange Wartezeiten gehabt (Visum lief bald ab). Der Operateur war ein absoluter Spezialist. Ich könnte noch einiges erzählen über indische Ärzte und Zahnärzte, die ohne Apparatemedizin treffende Diagnosen stellen können und (speziell Zahnärzte) mir mit Problemen halfen, die man in Deutschland zuvor angeblich nur durch Ziehen etlicher Zähne und Ersatz hätte beheben können. Einiges hält jetzt noch - dreißig Jahre später. Fünf Sterne für indische Ärzte und Zahnärzte. Hier ist es ja inzwischen so, dass die Ärzte überhaupt keine Diagnosen mehr stellen, das müssen die Maschinen machen. Wenn die Maschine nichts aussagt, hat man allenfalls Psyche.
Im Frühjahr hatte ich auch so ein Erlebnis ich hatte Schmerzen in der Ischias Gegend und vier Diagnosen bis man endlich wusste dass ich eine Entzündung am Beckenkamm hatte inzwischen unterscheide ich zwischen Ärzten und Medizinern
Meine älteste Tochter ist Krankenschwester und hat mir schon vor Jahren erzählt, dass sie sich nur eine Vollnarkose geben lassen würde, wenn es wirklich gar nicht anders geht.
Meine Großmutter hat nach einer Operation damals einfach aufgehört zu essen - ohne medizinische Indikation.
Sie wurde dann künstlich ernährt und ist wenige Monate später verstorben.
Mein Vater hatte eine Vollnarkose für eine Biopsie (unnötigerweise) nach der er 3 Tage gebraucht hat, um wieder halbwegs orientiert zu sein. Er wurde dann - trotz negativer Biopsieergebnisse - als Lungenkrebs-Patient behandelt und operiert.
Es ist wirklich schrecklich, was die Medizin den Menschen inzwischen alles antut. Aus Angst, aus Unkenntnis oder auch aus Profitgier... Ich könnte inzwischen ein Buch darüber schreiben. Lebe selbst seit 4 Jahren (unbehandelt) mit diagnostiziertem bösartigen Krebs.