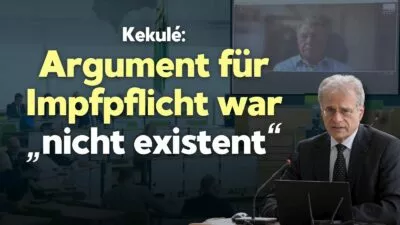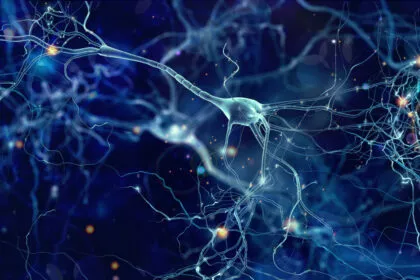Gigantische Summen und ein Tabubruch: Was steckt im neuen Finanzpaket?
Union und SPD haben bei Sondierungen eine Einigung über Finanzfragen erzielt. Es geht um sehr viel Geld. Verteidigungsausgaben sollen ab 1 Prozent der Wirtschaftsleistung von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Was bedeutet das?

Im Reichstagsgebäude und dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (vorn) berät die deutsche Regierung über die nächsten Schritte.
Foto: Jarama/iStock
Es sind gigantische Summen – und eine Überraschung: Union und SPD wollen nicht nur ein Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur schaffen, sondern für Verteidigungsausgaben auch an die Schuldenbremse ran. Das hatte die Union zuletzt noch ausgeschlossen. Für einen Beschluss im Bundestag sind die Stimmen von Grünen oder FDP nötig.
Was ist der Vorschlag?
- Die Schuldenbremse soll für Verteidigungsausgaben gelockert werden. Verteidigungsausgaben, die über 1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen, sollen davon ausgenommen werden.
- Ein Sondervermögen für die Infrastruktur wird geschaffen. Es umfasst 500 Milliarden Euro über eine Dauer von zehn Jahren. Die Kommunen und Bundesländer erhalten davon 100 Milliarden Euro.
- Die Bundesländer können sich künftig in Höhe von 0,35 Prozent des BIP jährlich neu verschulden.
- Es wird ein Planungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz für die Bundeswehr geschaffen.
- Es wird eine Prioritätenliste geschaffen, die schnell zu beschaffende Rüstungsmaterialien umfasst.
- Diese Festlegungen sollen noch vom alten Bundestag beschlossen werden. Im neuen Bundestag haben Union und SPD nicht mehr die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit.
- Es wird eine Expertenkommission eingesetzt, die einen Vorschlag für eine Reform der Schuldenbremse entwickelt. Die neue Gesetzgebung dazu soll bis Ende 2025 verabschiedet sein.
Was heißt das?
Welche Chancen haben die Pläne im Bundestag?
Wer muss die Kredite bezahlen?
Warum ist mehr Geld für die Bundeswehr nötig?
Warum braucht der Bund so viel Geld für die Infrastruktur?
Was könnte ein Sondervermögen Infrastruktur bewirken?
Kommentare
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
Deutschland hat seine Steuereinnahmen in gut zehn Jahren fast verdoppelt. Wo ist das Geld abgeflossen? Je mehr Geld Politiker zur Verfügung haben, desto leichtfertiger geben sie es aus. Der Import bildungsferner Armut, massive Eingriffe in den Wohnungsmarkt mit Steuergeldern, völlig enthemmte Entwicklunghilfe die keine ist, Steuerverschwendung im Inland und in Brüssel usw. Dieses System presst seine Bürger weiter aus und wird dadurch noch mehr Einnahmen generieren, um noch mehr zu verschwenden. Wer beendet diesen Teufekskreis? Das massiv abwandernde Kapital wird diesen Ausgabensumpf trocken legen. Anders geht es nicht!
Wem will Herr Merz als Bundeskanzler eigentlich dienen???
[] Im Wahlkampf vom Erhalt der Schuldenbremse faseln, Sparmaßnahmen versprechen etc.pp., und EINEN TAG nach der Wahl wird mit SCHULDEN GEKLOTZT, als gäbe es kein Morgen! Um dem riesigen fast BILLIONEN SCHULDEN-PAKET einen "seriösen Touch" zu geben, werden alle diejenigen Versäumnisse aufgeführt, welche man in den letzten Jahren selber VERSCHULDET hat, z.B. Sanierung von Brücken, Schulen und Kitas, und tut so, als ob die Hälfte des Paketes für "zivile Infrastruktur-Zwecke" vorgesehen wären. Nein, diesen Ampelpolitikern kann man KEIN WORT mehr glauben, die reißen uns und die nächsten Generationen in den Abgrund.
9
Kommentare
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
Deutschland hat seine Steuereinnahmen in gut zehn Jahren fast verdoppelt. Wo ist das Geld abgeflossen? Je mehr Geld Politiker zur Verfügung haben, desto leichtfertiger geben sie es aus. Der Import bildungsferner Armut, massive Eingriffe in den Wohnungsmarkt mit Steuergeldern, völlig enthemmte Entwicklunghilfe die keine ist, Steuerverschwendung im Inland und in Brüssel usw. Dieses System presst seine Bürger weiter aus und wird dadurch noch mehr Einnahmen generieren, um noch mehr zu verschwenden. Wer beendet diesen Teufekskreis? Das massiv abwandernde Kapital wird diesen Ausgabensumpf trocken legen. Anders geht es nicht!
Wem will Herr Merz als Bundeskanzler eigentlich dienen???
[] Im Wahlkampf vom Erhalt der Schuldenbremse faseln, Sparmaßnahmen versprechen etc.pp., und EINEN TAG nach der Wahl wird mit SCHULDEN GEKLOTZT, als gäbe es kein Morgen! Um dem riesigen fast BILLIONEN SCHULDEN-PAKET einen "seriösen Touch" zu geben, werden alle diejenigen Versäumnisse aufgeführt, welche man in den letzten Jahren selber VERSCHULDET hat, z.B. Sanierung von Brücken, Schulen und Kitas, und tut so, als ob die Hälfte des Paketes für "zivile Infrastruktur-Zwecke" vorgesehen wären. Nein, diesen Ampelpolitikern kann man KEIN WORT mehr glauben, die reißen uns und die nächsten Generationen in den Abgrund.