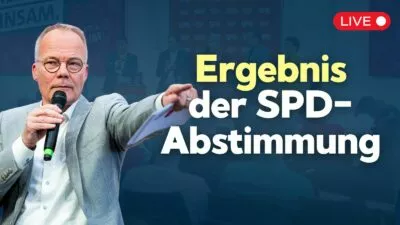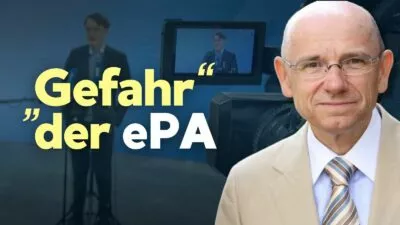Rechtsgutachten schafft Klarheit
Fernwärme-Zwang: Kann es auch Wärmepumpen-Besitzer treffen?
Mit der Wärmewende sollen sich laut der Politik vor allem zwei Heizvarianten etablieren: Wärmepumpe und Fernwärme. Es könnte zu einem Konflikt für Wärmepumpen-Besitzer kommen, wenn vor Ort ein Fernwärmenetz entsteht. Ein Rechtsgutachten schafft Klarheit.

Hunderttausende Immobilienbesitzer haben sich in den letzten Jahren eine Wärmepumpe einbauen lassen.
Foto: „BWP“
Mit der Einführung des Gebäudeenergiegesetzes will die deutsche Bundesregierung die Umstellung auf klimafreundlichere Heizsysteme beschleunigen. Demnach sollen bis spätestens Mitte 2028 alle neu installierten Heizungen mit 65 Prozent erneuerbarer Energie in Betrieb gehen. Ein bevorzugtes Heizsystem sind Wärmepumpen.
Gleichzeitig gibt es das Konzept der kommunalen Wärmeplanung, wobei in passenden Fällen die Haushalte an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden müssen.
Doch was gilt, wenn Hauseigentümer sich erst vor Kurzem eine Wärmepumpe eingebaut haben und ihr Gebäude danach an ein lokales Fernwärmenetz angeschlossen werden soll? Müssen sie die neue Wärmepumpe wieder abklemmen und ausbauen? Auch Immobilienbesitzer, die sich in der nächsten Zeit eine Wärmepumpe anschaffen möchten, stehen mancherorts vor dieser Frage.
Generell kein Anschlusszwang
Ein neues Rechtsgutachten des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP), verfasst von Dr. Miriam Vollmer, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Verwaltungsrecht, klärt über diesen möglichen Konflikt auf. Vollmer gibt Entwarnung für Wärmepumpen-Besitzer, zumindest für viele.
In der Regel müssen sich Gebäude mit einer bestehenden Heizungsanlage aufgrund eines geltenden Anschluss- und Benutzungszwangs an die Fernwärme anschließen, wenn ein solches Netz für die Region vorgesehen ist. Das Eigentumsgrundrecht gewähre dem Immobilienbesitzer hierbei keinen absoluten Schutz.
Deutlich höher ist der Schutz für all jene, die bereits mit einer Wärmepumpe offiziell emissionsfrei heizen. Laut dem Rechtsgutachten sind für Bayern und Brandenburg, in der Tendenz auch in Schleswig-Holstein, für diesen Fall schon gesetzliche Ausnahmen vorgesehen.
Emissionen im Fokus
Aber auch wenn die Landesgesetzgebung eines Bundeslandes hierfür keine Ausnahme definiert, soll für Wärmepumpen-Besitzer kein Anschlusszwang an das Fernwärmenetz gelten.
Im Mittelpunkt der Definition steht hierbei der Klimaschutz, und damit verbunden der Schutz der Gesundheit vor lokalen Emissionen. Laut Vollmer entfällt die Fernwärme-Anschlusspflicht, wenn die örtliche Fernwärme emissionsintensiver ist als der Betrieb einer bestehenden Wärmepumpe – auch wenn diese nur indirekte Emissionen durch den Stromverbrauch verursacht.
Fernwärme kann auf unterschiedliche Weise generiert werden. Wenn diese auf Verbrennungsvorgängen basiert, die CO₂-Emissionen verursachen, ist ein lokaler Anschlusszwang auch gegenüber Wärmepumpen laut dem Gutachten praktisch unmöglich.
Bundesländer ohne eine konkrete Festlegung sollen dennoch hierfür eine klare Ausnahme definieren. Es verbiete sich laut Vollmer, Eigentümern zwar die Beibehaltung der Wärmepumpe zu gestatten, sie aber gleichwohl zum Anschluss ans Fernwärmenetz mit freigestellter Benutzung zu verpflichten.
Im Kontext des Rechtsgutachtens bedeutet dies, dass Eigentümer ihre Wärmepumpen weiter betreiben dürfen, auch wenn ein Fernwärmeanschluss verfügbar ist und sie nicht verpflichtet sind, ausschließlich das Fernwärmenetz zu nutzen.
Bessere Planbarkeit durch Rechtsgutachten
Das Rechtsgutachten hat Dr. Martin Sabel, Geschäftsführer des BWP, in Auftrag gegeben, wie das Portal „Ingenieur.de“ berichtet. Er äußerte sich zufrieden mit dem Ergebnis.
„In vielen Städten und Gemeinden wird gerade erst mit der Wärmeplanung begonnen, auf belastbare Aussagen zum Ausbau von Fernwärmenetzen wird man dort noch einige Jahre warten müssen.“
Die Ausweisung als Wärmenetzausbaugebiet oder dezentrales Versorgungsgebiet sei dabei unverbindlich. Zudem könne man diese sogar unter Verweis auf sogenannte Prüfgebiete noch verschieben. Wird in einer Region ein Fernwärmenetzausbau angekündigt, können laut Sabel allerdings Jahrzehnte vergehen, bis es überhaupt dazu kommt.
Eine Rücknahme der Pläne sei dann stets möglich. „Auf dieser Grundlage können Hausbesitzer aber nicht planen. Unser Rechtsgutachten stellt nun klar: Niemand muss auf die Wärmeplanung warten“, sagte der Geschäftsführer.
Nach Ansicht von Sabel besteht keinerlei Konflikt zwischen Wärmepumpe und Fernwärme. Denn die Mehrheit der Wohngebäude in Deutschland befinde sich nicht in den Ballungsräumen oder den Innenstädten. „Vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser stehen zumeist in Randbezirken von Städten oder im ländlichen Raum, wo sich aufgrund der geringen Bebauungsdichte ohnehin kein Wärmenetz lohnt. Konflikte mit dem Fernwärmeausbau treten daher nur selten auf“, so Sabel.
Er teilte mit, dass die Kommunen aufgrund des Wärmeplanungsgesetzes noch vor Beginn einer Wärmeplanungsphase klarstellen können, welche Immobilienbesitzer nicht mit einem Wärmenetz rechnen müssen.
Aktuelle Artikel des Autors
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.