
Potz Blitz und Donnerwetter: Können „Gewitter-Kraftwerke“ die Energiewende unterstützen?

Blitz und Donner sind Gegenstand von Göttersagen, Liedern und Redewendungen – meist um großes Erstaunen auszudrücken –, aber auch die moderne Wissenschaft beschäftigt sich mit ihnen. Die Physik hinter Gewittern ist denkbar einfach: Es handelt sich um den Ladungsaustausch, sprich einen Stromfluss zwischen zwei Luftschichten.
Umso beachtlicher sind die gewaltigen Kräfte, die sie freisetzen: gleißend helle Blitze, die sich über hunderte Kilometer erstrecken können, Temperaturen, die Luft zum Explodieren bringen und eine Geräuschkulisse, die jedes Rockkonzert übertönen kann.
Luft + Ladung = Blitz
Ein Blitz wird durch ein elektrisches Feld in einer Gewitterwolke ausgelöst. In den Wolken trennen sich die Ladungen: Die winzigen Eiskristalle laden sich positiv auf, die Wassertropfen negativ. Der kalte obere Teil der Wolke ist dann positiv geladen der untere Teil negativ. Schließlich entlädt sich die Energie – in einem Blitz.
Dieser kann die Luft auf etwa 30.000 Grad Celsius erhitzen und eine Länge von vielen Kilometern erreichen. So erstreckte sich der längste jemals gemessene Blitz laut der Welt-Wetterorganisation WMO über mehr als 750 Kilometer durch die USA.
Diese Entladungen können unterschiedliche Formen annehmen, wobei insbesondere die Erdentladungen zwischen Wolken und Boden als besonders gefährlich gelten. Wolkenentladungen bleiben hingegen innerhalb einer Gewitterwolke und lassen den Himmel aufleuchten. Luftentladungen richten sich in den Luftraum, ohne den Boden zu erreichen.
So viel (oder wenig) Energie steckt in einem Blitz
Erfolgt der Ladungsausgleich zwischen Luft und Erde, „schlägt der Blitz ein“. Blitze können eine Stromstärke von mehr als 100.000 Ampere und Spannungen von mehreren 100 Millionen Volt erreichen. Die Energie von Blitzen technisch nutzbar zu machen, ist bis heute nicht gelungen.
Das Hauptproblem liegt dabei in der Natur der Blitze: Sie sind zu schnell. „Ein Blitzeinschlag dauert nur wenige Tausendstelsekunden und ist damit viel zu kurz, um in nennenswertem Umfang nutzbare Energie zu übertragen“, schreibt E·ON. Im Moment der Entladung betrage die Blitz-Energie circa 280 Kilowattstunden. Den Großteil gebe der Blitz jedoch bereits bei der Entstehung an die Umgebung ab. Die Energie verpufft. Wortwörtlich.
Auch wenn es gelingen sollte, wäre es laut dem Energieversorger nicht sonderlich kraftvoll: „Könnte man Blitze einfangen und ihre elektrische Energie in einer Batterie speichern, hätte man pro Blitz lediglich rund 16 Kilowattstunden gewonnen – genug, um etwa 12 Stunden lang Haare zu föhnen.“
Warum der Donner grollt
Der Donner, der nach einer Entladung folgt, ist das Ergebnis der explosionsartigen Erhitzung der Luft im Blitzkanal. Das ist auch der Grund, warum nicht viel von der Energie, am Boden ankommt. Durch die Erhitzung der Luftmoleküle entsteht einerseits das Blitzleuchten, andererseits dehnt sich die Luft schlagartig in alle Richtungen aus und erzeugt eine Druckwelle, die durch die Umgebung rast. So schnell wie sie sich ausgedehnt hat, fällt die Luft jedoch auch wieder zusammen. Unser Ohr nimmt sowohl Druckwelle als auch das Zusammenschlagen als markanten Donner wahr.
Liegt der Blitzkanal rechtwinklig zum Beobachter oder der Beobachterin, kommen alle Schallwellen zur gleichen Zeit an. Dann ist der Donner ein Knall. Ist der Blitzkanal hingegen zur Person geneigt, treffen die Druckwellen von den verschiedenen Orten des Blitzkanals zu verschiedenen Zeiten ein. Dadurch entsteht ein anhaltendes Donnergrollen.
Um die Entfernung eines Blitzes zu schätzen, kann man die sogenannte Sekundenregel anwenden. Während der Blitz fast zeitgleich zum Auftreten zu sehen ist, schafft Schall etwa 330 Meter pro Sekunde. Zählt man die Zeit zwischen der sichtbaren Entladung und dem Donner, lässt sich die Entfernung zum Blitz abschätzen: Drei Sekunden entsprechen etwa einem Kilometer.
Welche Gefahren durch Blitzeinschläge entstehen
Mitunter passiert es auch, dass Menschen vom Blitz getroffen werden. Das ist nicht ungefährlich und kann zu Verbrennungen, Lähmungen oder sogar Herzstillstand führen. In Deutschland werden rund ein Dutzend Menschen pro Jahr getroffen, etwa zwei Drittel überleben. Viele Blitzopfer entwickeln zudem ein markantes Muster auf der Haut, sogenannte Lichtenberg-Figuren, manchmal auch Blitz-Tattoo genannt. Sie können sowohl nach wenigen Tagen verschwinden als auch ein Leben lang erhalten bleiben.
Schützen kann man sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am besten in festen Gebäuden oder im Auto. Dank der Metallkarosserie fließt der Strom außen ab. Die Wahrscheinlichkeit einmal in seiner Lebenszeit vom Blitz getroffen zu werden, liegt bei etwa 1 zu 12.000.
Sogenannte Trockenblitze schlagen zwischen Wolken und Erde ein, ohne dass in der Nähe Regen fällt. Insbesondere nach langen Trockenperioden ist dabei nicht auszuschließen, dass dadurch Brände entstehen. Der DWD schreibt dazu:
„Von einem Trockengewitter spricht man, wenn in einer sehr trockenen Luftmasse der gesamte Regen zwischen Wolkenuntergrenze und Boden verdunstet, bevor er den Boden erreicht. Solche Trockengewitter kommen in Deutschland sehr selten vor. Über der Iberischen Halbinsel und im Westen der Vereinigten Staaten […] treten sie jedoch häufiger auf, da dort die Strecke zwischen der Wolkenuntergrenze und dem Boden, in der der Regen verdunsten kann, deutlich länger ist (bis zu 4000 m) als in Mitteleuropa (meist nur bis zu 1500 m).“
In Deutschland können Trockenblitze auftreten, wenn das Gewittergebiet, das normalerweise Regen mitbringt, nicht über den Ort des Einschlags zieht oder nur geringe Niederschläge hinterlässt.
Warum Geruch den Regen ankündigt
Den Geruch, der während eines Sommerregens in der Luft liegt, nennen Forscher Petrichor. Der Name geht auf Isabel Bear und Dick Thomas zurück, zwei Australier, die den Begriff erstmalig im März 1964 verwendeten. Sie leiteten ihn von den altgriechischen Wörtern „petros“ (Stein) und „Ichor“ (mythologisch die Flüssigkeit in den Adern der Götter) ab.
Bear und Thomas entdeckten, wenn Regen auf den Boden trifft, wirbelt das Wasser Staubpartikel auf, die unter anderem das Aroma eines Öls freisetzen, welches Pflanzen bei Dürre produzieren. Der Wind verteilt diese Duftstoffe, sodass man manchmal den Regen riechen kann, bevor er überhaupt am eigenen Standort fällt.
Das Phänomen kann auch in den kalten Tagen vorkommen, tritt jedoch hauptsächlich in den Sommermonaten auf. Dafür müsse der Boden schon etwas erwärmt sein, erklärt der DWD. Das könne auch prinzipiell in den Wintermonaten passieren. Die Voraussetzungen seien hier allerdings wesentlich seltener erfüllt.
(Mit Material der dpa)




























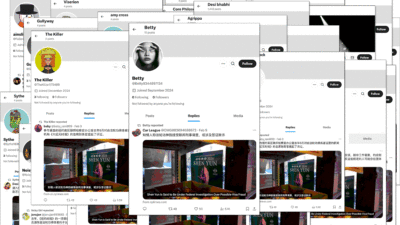








vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion