
Schering widersetzt sich Übernahmeplänen Mercks
Berlin – Der Berliner Pharmakonzern Schering widersetzt sich weiter vehement einer feindlichen Übernahme durch den Konkurrenten Merck. Der Aufsichtsrat bezeichnete das Angebot des Darmstädter Familienunternehmens von 77 Euro je Schering-Aktie am Dienstagabend als zu niedrig. Damit stärkte der Aufsichtsrat dem Vorstand den Rücken. Merck strebt nach eigenen Angaben trotzdem weiter eine Verhandlungslösung an. In Berlin wuchs unterdessen die Sorge um den Verlust tausender Arbeitsplätze in der Schering-Zentrale.
Vorstandschef Hubertus Erlen berichtete, der Aufsichtsrat Scherings habe die Offerte des Konkurrenten abgelehnt. Damit ist das Angebot auch offiziell ein feindlicher Übernahmeversuch. Erlen erklärte: «Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind sich einig, dass das Unternehmen alle Optionen ergreifen soll, eigenständig den Wert von Schering weiter in der Zukunft zu steigern.»
Zuvor hatte er betont, Schering sei zwar Spezialist, aber in großen Nischen mit hohen Wachstumsraten sehr erfolgreich. «Ich sehe daher aus dem Geschäft heraus keine Notwendigkeit, mit anderen zusammenzugehen.»
Erlen beklagte, Merck habe «nicht gerade klar gemacht, was denn eigentlich die Strategie sein soll». Ihm leuchte zum Beispiel nicht ein, warum das in weiten Teilen unterschiedliche Geschäft Mercks die Schering-Geschäfte stärken sollte. Spekulationen über einen «weißen Ritter», also das Hinzutreten eines freundlich gesonnenen zweiten Bieters, wollte Erlen nicht kommentieren. Auch zu möglichen Übernahmeplänen Scherings sagte der Vorstandsvorsitzende nichts.
Merck-Sprecher Walter Huber sagte unterdessen zum vorgelegten Angebot seines Unternehmens: «Beim Preis sind wir fest.» Das Unternehmen will den Berliner Konzern für 14,6 Milliarden Euro schlucken. Das Schering-Papier gab nach dem Höhenflug am Montag nur leicht nach: Bis zum Abend büßte es um ein Prozent auf rund 83,75 Euro ein.
Sorge um Wirtschaftsstandort Berlin
Den Abbau von Stellen hatte Merck ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Der Berliner Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit äußerte daraufhin Sorge um die Arbeitsplätze in Berlin sowie den Verbleib der Firmenzentrale und wichtiger Vorstandsfunktionen. Der CDU-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl, Friedbert Pflüger, forderte Merck auf, auf die Übernahme zu verzichten. In einem Brief an den Merck-Aufsichtsratschef Wilhelm Simson schrieb er: «Die Argumente, die Sie anführen, überzeugen hier nicht.»
Schering-Chef Erlen sagte zur Abwehrstrategie: «Das beste, was wir tun können, ist das zu tun, was wir bisher getan haben: Also zu wachsen, den Ertrag zu steigern und unsere Produkt-Pipeline abzuarbeiten.» Er wolle die Schering-Aktionäre überzeugen, «dass unser Geschäftswert so attraktiv ist, das er das von Merck abgegebene Angebot übertrifft».
Erlen zog die von Merck ins Gespräch gebrachten Synergieeffekte von 500 Millionen Euro in Zweifel. Dahinter könnten Pläne für einen umfangreichen Stellenabbau stecken.
Merck-Sprecher Huber sagte, ein höherer Angebotspreis berge die Gefahr eines anschließenden Verkaufs von Unternehmensbestandteilen der Schering AG. «Das wollen wir nicht.» Merck werde im Fall einer Übernahme die Konzernzentrale in Darmstadt belassen. Man werde bei Schering aber weder das Unternehmen noch den Standort zerschlagen: «Wir sind kein Finanzhai.» Ein Zusammenschluss mit Merck biete auch für die Mitarbeiter von Schering große Vorteile.


















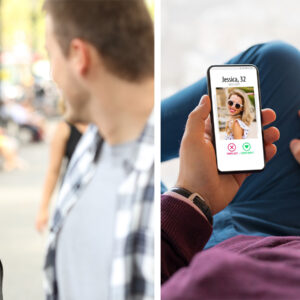









vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion