
Kohleausstieg in der Lausitz: Bis zu 1,75 Milliarden Euro Entschädigung für LEAG

Die EU-Kommission in Brüssel hat dem Grunde nach grünes Licht für eine Entschädigung des Bergbauunternehmens LEAG gegeben. Dies hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Dienstag, dem 4. Juni, verkündet. Die Zusage folgt der bereits im Vorjahr erteilten Genehmigung für Entschädigungen zugunsten von RWE für einen möglichen vorgezogenen Kohleausstieg in Westdeutschland. Die zum tschechischen Kretinsky-Konzern zählende LEAG betreibt ihre Kohlekraftwerke in der Lausitz.
Das Geld soll vorwiegend die Renaturierung der Region absichern, die sich über Teile Sachsens und Brandenburgs erstreckt. Außerdem soll es soziale Kosten ausgleichen, die im Fall eines vorzeitigen Kohleausstiegs zum Tragen kämen – etwa durch Jobverluste und die Erforderlichkeit von Umschulungen.
Entscheidung der EU-Kommission folgt im Grundsatz jener zu RWE
Im Fall von RWE hat die EU-Kommission eine Entschädigung von 2,6 Milliarden Euro als Ausgleich für eine Abschaltung seiner Braunkohlekraftwerke bis 2030 bewilligt. Ursprünglich geht die Ampel von einer Produktion und Verstromung von Kohle bis 2038 aus. Im „Konsens“ mit den betroffenen Stakeholdern soll jedoch ein vorgezogenes Aus bis „idealerweise“ 2030 möglich werden. In NRW ist eine solche Einigung mit RWE bereits erfolgt – vorbehaltlich eines später noch möglichen Reservebetriebs.
Die Entschädigung soll vor allem dann zum Tragen kommen, wenn die Kohleverstromung „marktgetrieben“ unrentabel werden sollte. Die politisch angeordnete Verteuerung des CO₂-Preises im Emissionshandel könnte diese Situation bereits vor 2038 eintreten lassen. Für den Fall, dass Kohleverstromung sich dann nicht mehr rechnen könnte, will Habeck sich bereits jetzt vorbereiten.
Der Minister verspricht sich zusätzliche Spielräume, um flexibel auf unterschiedliche Szenarien reagieren zu können. Immerhin rechnet auch er damit, dass mit einem gut ausgebauten Stromnetz die Versorgung mit erneuerbaren Energien immer sicherer werde. Zudem könnten bis Mitte der 2030er-Jahre auch neue Gaskraftwerke zur Verfügung stehen, die sich auf Wasserstoff umstellen ließen.
LEAG begrüßt von Habeck verkündete Einigung
Im Fall der LEAG gibt es bis dato erst eine Grundsatzentscheidung. Die EU-Kommission spricht von einer „vorläufigen“ beihilferechtlichen Bewertung möglicher Entschädigungen an die LEAG im Fall eines vorzeitigen Braunkohleausstiegs. Aus Sicht des Bundes könnten Zahlungen im Umfang von bis zu 1,75 Milliarden Euro in diesem Kontext fällig werden.
Die EU-Kommission sieht Habecks Schilderungen zufolge bis zu 1,2 Milliarden Euro für zu erwartende „Fixkosten“ offenbar schon jetzt als nachvollziehbar an. Diese beziehen sich auf Folgekosten aus dem Tagebau selbst – vor allem für Maßnahmen der Renaturierung – sowie auf Sozialkosten infolge des Strukturwandels. Die übrigen bis zu 550 Millionen Euro hängen demgegenüber vom Zeitpunkt des tatsächlichen Kohleausstiegs der LEAG ab. Wie das Ministerium mitteilt, ist deren Ausfolgung dann an Voraussetzungen gebunden.
Bei der LEAG selbst begrüßt man die Mitteilung vonseiten des Ministeriums. Deren Vorstandsvorsitzender Thorsten Kramer nahm zusammen mit Minister Habeck und den Wirtschaftsministern von Sachsen und Brandenburg, Ines Fröhlich und Jörg Steinbach, am Dienstag an einer Pressekonferenz teil. Das Unternehmen sicherte die erforderliche Arbeit, die notwendig sei, um die Auszahlung der Mittel zu gewährleisten.
Zwischen den Zeilen klingt Restunsicherheit an
Die Entschädigungssumme soll nicht an das Unternehmen oder seine Gesellschafter selbst fließen. Stattdessen wird dieses zusammen mit den Ländern Brandenburg und Sachsen Vorsorgegesellschaften gründen. Von dort aus soll die Summe ausschließlich für die Finanzierung der Wiedernutzbarmachung der von den Tagebauen beanspruchten Flächen zur Verfügung stehen. In der Erklärung gibt die LEAG auch einer klaren Erwartung an den Bund Ausdruck:
„Das Unternehmen erwartet in den kommenden Monaten auch, dass der Bund seine Zusage einhalten wird, die Auszahlung der heute durch das BMWK verkündeten Festbeträge in Höhe von 1,2 Milliarden Euro sowie die vollumfängliche Genehmigung der 1,75 Milliarden Euro zu ermöglichen und das Beihilfeverfahren nunmehr zu einem erfolgreichen Ende zu führen.“
Damit deutet der Konzern jedoch eine offenbare Restunsicherheit an bezüglich der tatsächlichen Billigung der in Rede stehenden Leistungen durch die EU-Kommission. So sei „noch zu klären“, in „welcher Form die infolge des vorzeitigen Ausstiegs aus der Kohleverstromung entgangenen Gewinne nachgewiesen und anerkannt werden sollen“. Das Unternehmen unterstreicht, alle erforderlichen Informationen und Dokumente beigebracht zu haben. Außerdem habe man „in den vergangenen Monaten in dem Beihilfeverfahren sehr intensiv und konstruktiv mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zusammengearbeitet“.
Wirtschaftsmagazin zweifelt Anspruch der LEAG auf Entschädigung an
Von einer solchen Restunsicherheit geht man auch bei der „Wirtschaftswoche“ aus. In deren Morgenbriefing „Daily Punch“ macht Chefreporter Florian Güßgen darauf aufmerksam, dass es noch keinen rechtskräftigen Bescheid aus Brüssel gibt. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager habe lediglich eine Einigung „im Grundsatz“ ohne finanzielle Details in einem Brief bestätigt. Das bedeute jedoch:
„Kaufen kann man sich von so einer Einigung: nichts. Rechtssicher ist sie auch nicht.“
Dass Habeck nun mit dieser Einigung vorpresche, wecke einen Verdacht. Der Minister wolle möglicherweise „ein paar Tage vor der Europawahl vor allem in Ostdeutschland den Anschein erwecken will, dass er liefert“.
Es sei insbesondere wenig wahrscheinlich, dass die LEAG die von ihr begehrten 550 Millionen Euro als Entschädigung bekommen werde. Immerhin sei es nicht erkennbar, warum der Konzern für entgangene Gewinne entschädigt werden solle, die nicht entstehen würden, wenn marktgetrieben der Kohlestrom keine Gewinne abgeworfen hätte.
Restunsicherheit auch bezüglich der ausreichenden Höhe von Mitteln für Renaturierung
Auch äußert das Magazin Zweifel daran, dass die Renaturierung der Lausitz durch die Entschädigungszahlungen abgesichert sei, wie die Bundesregierung dies betone. Die LEAG müsse für die Rekultivierung der Tagebaue Rückstellungen bilden und habe 2022 dafür 2,64 Milliarden Euro vorgesehen.
Da Zweifel an der Insolvenzfestigkeit dieser Rückstellungen bestünden, müsse die LEAG zusätzlich Geld in zwei Zweckgesellschaften für Brandenburg und Sachsen einzahlen. Diesen kämen Pfandrechte an den Mitteln zu. Ende 2024 sollen sich in diesen Gesellschaften 900 Millionen Euro befinden, heißt es weiter. Zu diesen sollen nun die mindestens 1,2 Milliarden Euro aus Entschädigungszahlungen hinzukommen. Allerdings sei die Summe zur Hälfte für Renaturierung und zur Hälfte für Sozialleistungen gedacht. Dieser Umstand mache es unsicher, ob die Mittel für die Renaturierung ausreichten.
Die LEAG will ihrerseits eine „Transformation“ ihrer Geschäftsfelder einleiten. Dazu gehören den Konzernplänen zufolge der Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke und einer „Gigawattfactory“ mit Wind- und Sonnenkraft auf den Tagebauflächen. Organisatorisch werde das grüne Geschäftsfeld von der Kohle getrennt, um besser Kapital aufnehmen zu können.
Steuerzahler trägt Kosten für politisches Experiment
Auch wenn die nunmehrige Entscheidung aus Brüssel dem Bund tatsächlich mehr Spielraum und Unternehmen wie auch Beschäftigten mehr Planungssicherheit geben sollte, steht am Ende dennoch ein ideologisch begründetes Experiment, für das die Bürger in ihrer Eigenschaft als Steuerzahler geradestehen.
Wird der Betrieb der Kraftwerke aufgrund der hohen CO₂-Preise unrentabel, ist das – entgegen dem politischen Narrativ – keine marktbedingte Entwicklung. Die Produktion würde ja nicht unrentabel, weil es keine Nachfrage nach dem Produkt mehr gäbe, sondern, weil dessen Preis für viele nicht mehr bezahlbar wäre. Diese Verteuerung wäre jedoch kein Resultat tatsächlicher Knappheit oder fehlender Kapazitäten, sondern des politischen Versuchs, tatsächliche oder behauptete externe Kosten der Produktion durch hoheitliche Maßnahmen zu internalisieren.
Eine marktbedingte Unrentabilität der Produktion und Verstromung von Kohle würde voraussetzen, dass die von der Politik forcierten erneuerbaren Energien tatsächliche Vorteile bezüglich Kosten und Effizienz bieten. Dies wäre der Fall, wenn daraus gewonnene Energie zu jeder Zeit stabil und in ausreichendem Maße verfügbar wäre.
Wettlauf mit der Zeit um ausreichende Energieversorgung?
Derzeit produzieren beispielsweise Windkraftwerke im Norden des Landes mehr Strom, als vor Ort benötigt wird. Es fehlt jedoch an den Lösungen für die Speicherung nicht nachgefragter Energieerzeugung und an der Infrastruktur zum Transport in unterversorgte Regionen. Diese befinden sich beispielsweise in den hochindustrialisierten Gebieten des Westens, des Südens und auch in Ballungsgebieten wie jenem um Halle und Leipzig.
Dieses Ungleichgewicht zwischen Nord und Süd und fehlende Stromtrassen sind der Hauptgrund dafür, dass Strom knapp und teuer ist. Der Ausstieg aus der Kernkraft trägt zusätzlich zur Verknappung des Angebots bei. Bis dato versucht der Bund, der Entwicklung durch zusätzliche Stromerzeugung aus Kohle gegenzusteuern. Soll nun ein politisch in die Höhe getriebener CO₂-Preis diese künstlich verteuern, droht ein Wettlauf mit der Zeit um die Gewährleistung der Energieversorgung. Dieser ist nur zu gewinnen, wenn zeitnah genug Antworten auf die Frage gefunden werden, wie die Erneuerbaren eine dauerhafte, stabile, sichere und bezahlbare Versorgung gewährleisten können.









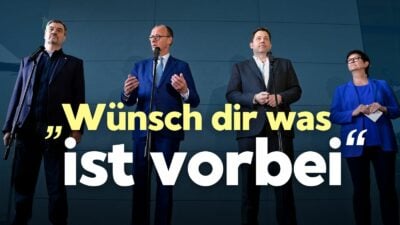
![A100 in Berlin: So geht es nach der Stillegung der Ringbahnbrücke weiter [Pressekonferenz]](https://images-de.epochtimes.de/uploads/2025/03/Thumbnail-Autobahn-GmbH-Update-Berlin-400x225.jpg)







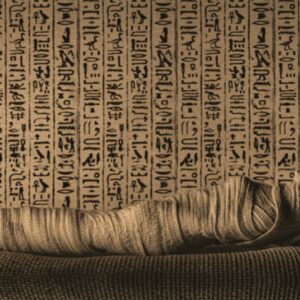











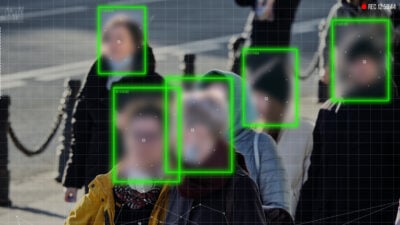



vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion