
Zwei Urteile: Mehr Rechte für Migranten, mehr Pflichten für Behörden

Ein Mensch, der bereits in einem EU-Mitgliedstaat als Flüchtling anerkannt worden ist, muss in einem anderen EU-Staat zwar nicht automatisch als Flüchtling anerkannt werden, er hat an seinem neuen Aufenthaltsort aber das Recht, erneut einen Antrag auf internationalen Schutz zu stellen, sofern die Rückkehr in das erste Land für ihn die „ernsthafte Gefahr“ bedeuten würde, vor Ort einer „unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt“ zu werden. Das hat die Große Kammer des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) in Luxemburg am 18. Juni 2024 entschieden.
Der Staat, in den der Flüchtling weitergezogen sei, müsse in diesem Fall individuell prüfen, ob die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft allgemein zuträfen. Dabei seien zwingend die Erkenntnisse jener ausländischen Behörde zu berücksichtigen, die bereits den Flüchtlingsstatus zugebilligt hatte (Az. C-753/22, PDF).
Deutschland muss Entscheidungsgrundlage Griechenlands berücksichtigen
Im zugrunde liegenden Fall einer Syrerin, die erst erfolgreich in Griechenland, dann erfolglos in Deutschland Asyl beantragt hatte, müsse die zuständige Behörde nun „eine neue individuelle, vollständige und aktualisierte Prüfung der Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft vornehmen“, entschied der EuGH.
Dabei seien von deutscher Seite aus sowohl die vorausgegangene Entscheidung der griechischen Behörde pro Flüchtlingsstatus als auch die Anhaltspunkte, auf denen diese Entscheidung beruht habe, „in vollem Umfang“ zu berücksichtigen. Die deutsche Behörde habe sich zum Informationsaustausch jetzt „unverzüglich“ an ihr griechisches Pendant zu wenden, verlangte der EuGH. Ein Ermessensspielraum für Deutschland bestehe nicht:
Erfüllt der Antragsteller die Voraussetzungen für die Anerkennung als Flüchtling, muss die Behörde ihm diese Eigenschaft zuerkennen, ohne hierbei über ein Ermessen zu verfügen.“
BVerwG wollte Klarheit
Hintergrund war der Fall um eine syrische Staatsangehörige, die 2018 in Griechenland offiziell einen Flüchtlingsstatus erlangt hatte, dann aber nach Deutschland weitergezogen war. Dort hatte ihr ein Verwaltungsgericht rechtskräftig zugebilligt, nicht nach Griechenland zurückkehren zu müssen, weil ihr dort „die ernsthafte Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung im Sinne von Art. 4 GRC drohen würde“, wie es im Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) in Leipzig hieß (PDF).
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) lehnte einen Antrag der Syrerin auf Zuerkennung der vollen Flüchtlingseigenschaft am 1. Oktober 2019 allerdings ab und gewährte ihr lediglich den weniger umfangreichen „subsidiären Schutz“ nach Paragraf 4 Asylgesetz (AsylG).
Dagegen wehrte sich die 1999 geborene Frau unter Verweis auf die Feststellung der griechischen Behörden. Doch auch das Verwaltungsgericht Aachen wies ihre Klage am 19. August 2021 ab: In ihrer Heimat Syrien drohe der Frau wahrscheinlich gar keine flüchtlingsrelevante Verfolgung. In der Sache sei der Antrag der Klägerin auf vollen Flüchtlingsschutz also unbegründet (Az.: 1 K 2968/19). Nach deutschem Recht habe sie von daher keinen automatischen Anspruch auf den vollen Flüchtlingsstatus.
Rechtskraft erlangte das Urteil allerdings nicht. Der 1. Senat des BVerwG setzte das Verfahren in einem Sprung-Revisionsverfahren am 7. September 2022 wegen der komplexen Widersprüche zwischen nationalem und europäischem Recht aus und beschloss: Der EuGH sollte per Vorabentscheidung für Rechtsklarheit sorgen (Az.: 1 C 26.21). Dem wurde nun Genüge getan.

Das Pressefoto zeigt den Gebäudekomplex des EuGH in Luxemburg. Foto: Gerichtshof der Europäischen Union
Auslieferung an die Türkei abgelehnt
In einem weiteren Fall zum Asylrecht entschied der EuGH am selben Tag, dass ein Drittstaatsangehöriger nicht einfach in sein Herkunftsland ausgeliefert werden darf, wenn ein EU-Mitgliedstaat ihm bereits „die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt“ habe. Dies gelte „unabhängig von den Gründen, auf die das Auslieferungsersuchen gestützt“ werde.
Die „mit dem Auslieferungsersuchen befasste Behörde“ müsse erst die Behörde jenes Staates kontaktieren, der die Flüchtlingseigenschaft einst festgestellt hatte. Diese Behörde könne dann darüber entscheiden, den Status nachträglich abzuerkennen. Bevor dies nicht erfolgt sei, dürfe auf keinen Fall ausgeliefert werden (Az. C-352/22, PDF).
Auch diesem Urteil hatte ein Fall aus Deutschland zugrunde gelegen. Nach Darstellung des EuGH hatte die Türkei die Bundesrepublik um die Auslieferung eines Kurden mit türkischer Staatsangehörigkeit gebeten, der sich in seiner Heimat des Totschlags verdächtig gemacht hatte. Der Verdächtige sei bereits 2010 in Italien als Flüchtling anerkannt worden, weil er in der Türkei die Kurdische Arbeiterpartei (PKK) unterstützt und ihm deshalb die „politische Verfolgung durch die türkischen Behörden“ gedroht habe.
Im Heimatland darf kein Risiko unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung bestehen
„Solange die italienischen Behörden die Flüchtlingseigenschaft nicht aberkannt haben, ist die Auslieferung abzulehnen“, stellte der EuGH fest. Nun sei es „gemäß dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit“ an den deutschen Behörden, den Kontakt zu den italienischen Behörden aufzunehmen.
Auch wenn Italien den Flüchtlingsstatus aberkennen sollte, müsse die deutsche Behörde selbst zu dem Ergebnis kommen, „dass der Betroffene die Flüchtlingseigenschaft nicht oder nicht mehr besitzt“, so der EuGH. Und noch eine Bedingung machte der EuGH für eine Auslieferung zur Pflicht: Die deutsche Behörde müsse sich „vergewissern, dass im Fall der Auslieferung des Betroffenen an die Türkei für ihn dort kein ernsthaftes Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung“ bestehe.






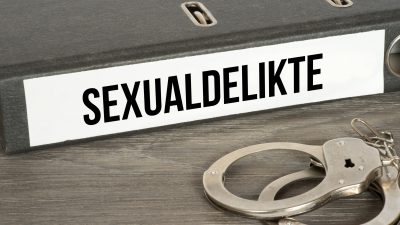
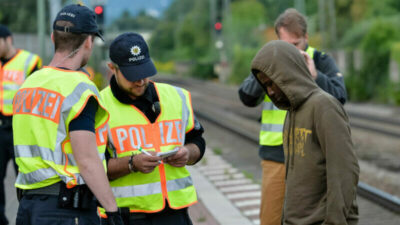

























vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion