
Kritische Staatsbürger oder linksautoritäre Tyrannen: Was bewirkt deutsche Demokratie-Erziehung?

Mehrere Landtagsfraktionen der AfD haben mittlerweile Portale eingerichtet, in denen Schüler Fälle vermeintlicher oder tatsächlicher Verletzungen des Neutralitätsgebots melden können.
Erst in den vergangenen Tagen wurden mehrere Vorfälle bekannt – beispielsweise aus den bayerischen Städten Landshut und Vilsbiburg –, in denen Pädagogen eine Teilnahme von Vertretern der im Europaparlament vertretenen AfD an Podiumsdiskussionen an Schulen verhinderten.
Nicht selten sind Lehrer selbst die treibenden Kräfte, wenn Schüler für politisch einseitige Projekte eingespannt werden, in denen es augenscheinlich eher darum geht, „Haltung“ einzuüben, als zu lernen, selbstständig und eigenverantwortlich informierte Urteile zu fällen.
Aber nicht nur, wenn es „gegen Rechts“ geht, lässt sich die Zahl jener Lehrkräfte, die Konformität als Gefahr und nicht als Ziel begreifen, möglicherweise an den Fingern einer Hand abzählen. Auch die mutwilligen Verstöße gegen geltende Gesetze, wenn es um die „Schulstreiks“ unter dem Banner von „Fridays for Future“ geht, erfreuen sich nicht selten der Duldung oder gar unverhohlenen Unterstützung durch die Lehrer selbst.
Tickende Zeitbombe
Die Folgen einseitiger politischer Indoktrination sind potenziell tickende Zeitbomben für ein freiheitliches Gemeinwesen. Schüler verlernen es, mit abweichenden Meinungen und Interessen umzugehen, oder sie werden sich nicht einmal darüber im Klaren, dass es solche überhaupt gibt. Manche von ihnen enden gar im politischen Extremismus, der am Ende gar vor strafbaren Handlungen wie dem Zerstören von Wahlplakaten oder gar der Ausübung von Gewalt gegen Andersdenkende nicht zurückschreckt.
Sind aber Selbstgerechtigkeit, Intoleranz und ein manichäisches Weltbild als Erziehungsziele bereits „im System“ angelegt, oder verhalten sich Gesetz und Praxis des Bildungswesens zueinander wie geschriebene Verfassung und Realverfassung?
Erst im Oktober 2018 wurde der Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) zur „Demokratie als Ziel, Gegenstand und Praxis historisch-politischer Bildung und Erziehung in der Schule“ überarbeitet, der in seiner ursprünglichen Fassung vom 6. März 2009 stammt.
Bereits in der Einleitung wird darin deutlich gemacht, dass die totalitären Erfahrungen des 20. Jahrhunderts zeigen, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie sie im Grundgesetz niedergelegt ist, nicht selbstverständlich ist und der breiten Unterstützung vonseiten der Öffentlichkeit bedarf, um erhalten zu bleiben. Als Ziel der schulischen Bildung und Erziehung wird unter anderem eine rechtsstaatliche Demokratie definiert, die sich „der Komplexität der Welt stellen“ könne.
Gewaltfreiheit und Multiperspektivität
Um dies zu bewerkstelligen, führt das Papier eine Reihe von grundsätzlichen Erwägungen auf, verweist auf Vereinbarungen mit nationalen und supranationalen Kooperationspartnern und benennt Dokumente, die der Umsetzung der darin verankerten Grundsätze dienlich sein könnten.
Die Kultusminister weisen auf Essentials wie die Bedeutung der Menschenwürde innerhalb der Ordnung hin, die das Grundgesetz festschreibt, ebenso auf die Grundrechte als Abwehrrechte gegen staatliche Willkür, aber auch als Ausdruck einer objektiven Wertordnung, wie das Bundesverfassungsgericht dies deutlich gemacht hat. Das pädagogische Handeln in Schulen sei „von demokratischen Werten und Haltungen getragen, die sich aus den Grundrechten des Grundgesetzes und aus den Menschenrechten ableiten lassen“.
Der KMK-Beschluss beschwört in weiterer Folge, wie wichtig es sei, die freiheitlich-demokratische Grundordnung auch als einen Ort der Pluralität zu begreifen. Die „Vermittlung belastbaren Wissens und Könnens“ schließe es in diesem Sinne auch ein, „sich selbst und andere in Frage zu stellen sowie Sprache und Kommunikation im Hinblick auf ihre expliziten und impliziten Aussagen zu reflektieren“.
Explizit benennt das Dokument die Wichtigkeit der Fähigkeit zum Perspektivwechsel oder den gewaltfreien Umgang mit Konflikten als wesentliche Lernziele. Mehrere Absätze widmen sich dem Beutelsbacher Konsens und dem darin verankerten Überwältigungs- und Indoktrinationsverbot.
„Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen“, heißt es darin unter anderem. Unterschiedliche Perspektiven sollten aufgezeigt und zugelassen werden – auch widerstreitende und umstrittene Positionen. Wo unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, sei „der Weg zur Indoktrination beschritten“.
„Beutelsbacher Konsens“ fällt Gefühlsdemokratie zum Opfer
Zudem gelte es, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass „auch beste Absichten bisweilen gegenteilige Wirkungen erzeugen. Überheblichkeit und Übereifer können dazu verleiten, nur die eigene Sicht gelten zu lassen. Kontroversen und Debatten trainieren die Fähigkeit zum Perspektivwechsel.
Eine Grenze bezüglich der Gleichbehandlung unterschiedlicher Standpunkte stelle dabei die freiheitlich-demokratische Grundordnung selbst dar.Forderungen wie die nach Errichtung einer „Diktatur des Proletariats“ oder einer Beschränkung politischer Rechte auf Angehörige der „weißen Rasse“ können Lehrkräfte demnach niemals als gleichwertig oder gleich legitim gelten lassen wie Auffassungen, die auf dem Boden der grundgesetzlich garantierten Menschenwürde stehen.
Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass unterschiedliche Einschätzungen zu Donald Trump, der AfD oder dem „menschengemachten Klimawandel“ zu vermitteln durchaus im Sinne des Beutelsbacher Konsenses liegen.
Im Kern scheinen die weit verbreitete Einseitigkeit und politische Schlagseite, die den realen Unterricht an vielen Schulen prägen, keine Grundlage in Dokumenten wie dem oben genannten Beschluss der Kultusministerkonferenz zu finden. Der „Beutelsbacher Konsens“ wird ebenso explizit erwähnt wie die Gefahren des Gruppendrucks oder eines selbstgerechten moralischen Rigorismus, der keine Rücksicht auf berechtigte Interessen anderer nimmt.
Das Wort „Freiheit“ findet sich selten
Dennoch lässt das Dokument selbst zumindest in Nuancen erkennen, warum der real existierende staatsbürgerliche Unterricht in Deutschland so aussieht, wie er aussieht – und nicht so, wie das geduldige Papier es vorsieht.
Es ist viel von „Vielfalt“, „Diversität“ oder „Gleichheit“ die Rede, aber selten von Freiheit. Das Wort „Freiheit“ kommt isoliert im gesamten Dokument nur einmal vor – und einige weitere Male im Zusammenhang mit der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ oder dem „freiheitlichen Rechtsstaat“, also im Wesentlichen im Sinne einer technischen Bezeichnung.
Der Demokratie als „Werteordnung“ wird ein deutlich höherer Stellenwert eingeräumt als ihrem eigentlichen Kerngehalt, nämlich der Legitimation staatlicher Hoheitsträger durch Wahl. Wenn jedoch im Zusammenhang mit staatsbürgerlicher Bildung der „Demokratie“ ein offenbar erheblich größerer Wert als der Freiheit beigemessen wird, diese sogar zur „Lebensform“ stilisiert wird, dann drängt sich der Eindruck auf, dass das gesamte Konzept möglicherweise das Thema verfehlt hat.
In den USA kommt der Begriff „Demokratie“ hingegen weder in der Unabhängigkeitserklärung noch in der Verfassung vor. Die Gründerväter definierten die Vereinigten Staaten als eine „konstitutionelle Republik“, die „Demokratie“ war nach ihrem Verständnis lediglich ein Verfahren, um die Amtsträger zu bestimmen, die die vorgesehenen Funktionen in der Legislative, der Exekutive und der Judikative bekleiden sollten.
Zentrale Elemente der US-Gründungsdokumente waren hingegen die Freiheit und die Rechtsstaatlichkeit („Rule of Law“). Die demokratische Wahl von staatlichen Amtsträgern war Ausdruck des Willens, eine Ordnung zu schaffen, die auf dem Prinzip des „Rule by the people“ beruht – allerdings verbunden mit einer umfassenden Beschränkung der Macht des Staates, um eine „Tyrannei der Mehrheit“ und „Mob Rule“ zu verhindern.
Staatszielbestimmungen als Gift für die Freiheit
Die US-Verfassung verzichtete bewusst auf Staatszielbestimmungen, weil diese einen aktiven staatlichen Handlungsauftrag begründen, der potenziell in Konflikt steht mit dem Ansinnen, die Macht des Staates gegenüber dem Einzelnen zu beschränken. Dass die politischen Parteien das deutsche Grundgesetz hingegen im Laufe der Zeit immer mehr und immer stärker mit Staatszielbestimmungen überfrachtet haben, schwächt dessen Potenzial, einer Unterminierung persönlicher Freiheitsrechte im Sinne gegenüber staatlichen Übergriffen im Namen des „Guten“ – das sich nicht selten auf ein Staatsziel beruft – wirksam gegenzusteuern.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Formulierung des Artikels 14 GG, die nicht einmal ein Staatsziel im eigentlichen Sinne normiert, aber Politikern wie Juso-Chef Kevin Kühnert ausreicht, um darauf eine faktische Abschaffung des Rechts auf Privateigentum stützen zu wollen.
Bereits die explizite Betonung von „Kinderrechten“ oder die „Stärkung junger Menschen in ihrem Engagement für den demokratischen Rechtsstaat und ihrem entschiedenen Eintreten gegen antidemokratische und menschenfeindliche Haltungen und Entwicklungen“ zeigt, dass die Kultusminister sich dieser Problematik nicht bewusst waren oder nicht bewusst sein wollten.
Denn ebenso wie „Kinderrechte“, wenn sie als eigene Kategorie neben Grund- und Menschenrechte treten, die ohnehin in der Verfassung verankert sind, entweder überflüssig sind oder aber ein „verstecktes Staatsziel“ beschreiben, das die Rechte von Familien einschränkt, ist auch die Begriffskombination „antidemokratische und menschenfeindliche Haltungen und Entwicklungen“ einer objektiven oder gar einer Legaldefinition nicht zugänglich.
Das Spiel mit den Buzzwords
Das Postulat, „Sprache und Kommunikation im Hinblick auf ihre expliziten und impliziten Aussagen zu reflektieren“, wie es an anderer Stelle Erwähnung fand, scheint hier zu kurz gekommen zu sein – ebenso, wenn an anderer Stelle ideologisch aufgeladene Begriffe wie „Fremdenfeindlichkeit“, „Sexismus“, „Homophobie“ oder „Islamfeindlichkeit“ als Phänomene genannt werden, die einer „fachlich fundierten Auseinandersetzung“ bedürfen.
Vermeintliche moralische Imperative haben in einem freien Gemeinwesen aber nun mal dort ihre Grenzen, wo andere die diesen zu Grunde liegenden Moralvorstellungen nicht teilen. Und je nachdem wird es der eine als „menschenfeindlich“ bewerten, Migranten, die Kinder mit sich führen, den Grenzübertritt zu verwehren – andere hingegen bewerten es als „menschenfeindlich“, Schwangerschaftsabbrüche für legitim zu halten oder Menschen nach deren „CO2-Abdruck“ zu bewerten.
Ebenso dürfte es je nach persönlichem ideologischem Standort unterschiedlich beurteilt werden, wo „Islamfeindlichkeit“ oder „Sexismus“ beginnt – viele sehen immerhin bereits Kritik an Forderungen des politischen Islam oder das Festhalten am traditionellen Familienbegriff in diesem Sinne als tatbestandsmäßig an.
Wenn es jedoch dem persönlichen Empfinden Einzelner oder einer gefühlten Mehrheit überlassen bleibt, was unter solchen dämonisierenden Beschreibungen zu verstehen ist, und wie man „entschiedenes Eintreten“ dagegen definiert, dann bewegt sich der Schulunterricht exakt auf die „besten Absichten“ zu, die „bisweilen gegenteilige Wirkungen erzeugen“ – und die exakt jene Überheblichkeit und jenen Übereifer nähren, vor dem das Papier der KMK an anderer Stelle so explizit warnt.
Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.





















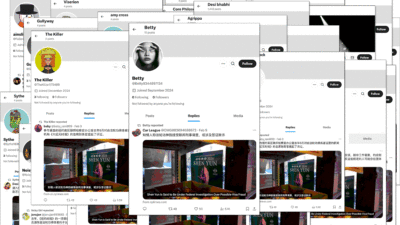








vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion