
Verwaltungsrichter zu Corona-Maßnahmen: „Auch in der Krise gilt die Verfassung“
In einem ausführlichen Interview mit der „Welt“ verwahrt sich der Vorsitzende des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter, Robert Seegmüller, gegen die jüngsten Aussagen von Kanzleramtschef Helge Braun. Dieser hatte es in der „Welt am Sonntag“ als „Herausforderung“ bezeichnet, wenn sich „die Gerichte auf den Gleichheitssatz berufen, um einzelne Maßnahmen aufzuheben oder zu modifizieren“. Zudem vertrat er die These, es sei „rechtlich unproblematisch“ gewesen, umfassende Maßnahmen zur Stilllegung des öffentlichen Lebens in der Anfangsphase der Pandemie anzuordnen.
Seegmüller meinte dazu, die Höchstgerichte befänden sich „nicht in einem Wettstreit mit der Regierung“. Allerdings sei es ihre Aufgabe, Gesetze und Rechtsakte auf ihre Übereinstimmung mit der Verfassung zu kontrollieren und notfalls zu sagen: „So geht es nicht, bis hierher und nicht weiter.“
Hat sich der Bundestag zu Unrecht selbst entmachtet?
Selbst angesichts der Tatsache, dass die Höchstgerichte – zu Beginn der Pandemie bereitwilliger, mittlerweile abwartender – im Eilverfahren zahlreiche grundrechtsrelevante Corona-Maßnahmen gebilligt haben, lasse sich nicht verbindlich sagen, ob diese auch tatsächlich rechtens waren: „Das werden wir erst wissen, wenn die Entscheidungen in der Hauptsache getroffen sind, sich die Gerichte also gründlich mit den Eindämmungsmaßnahmen befasst haben.“
Grundsätzlich sei angesichts der massivsten Grundrechtseingriffe in der Geschichte der Bundesrepublik das Parlament gefordert, die Regierung zu kontrollieren, mahnt Seegmüller.
Dieses habe es jedoch vorgezogen, die Ermächtigungsgrundlagen im Infektionsschutzgesetz zugunsten der Exekutive anzupassen. Das sei nicht zwingend bedenklich, da das Parlament sich seine Kompetenzen auch jederzeit zurückholen könne. Es sei jedoch offen, ob der Bundestag durch seine teilweise Selbstausschaltung zugunsten der Exekutive selbst verfassungsgemäß gehandelt habe.
Grundsätzlich seien die Verwaltungsgerichte auch der Exekutive in der Corona-Krise anfänglich weit entgegengekommen. In Verfahren bezüglich des vorläufigen Rechtsschutzes hätten die Gerichte „nur selten darauf geschaut, wie die Sache wahrscheinlich in einem Hauptverfahren ausgehen würde“. Sie hätten im Wesentlichen auf eine Folgenabwägung abgestellt, mit der Konsequenz, dass die mögliche Gefährdung von Leben und körperlicher Unversehrtheit regelmäßig den Ausschlag gegeben hätte.
Verwaltungsrichter prüfen allmählich strenger
Nach den ersten sechs Wochen der Pandemiemaßnahmen habe sich die Melodie schon etwas geändert. Die Gerichte würden auch im Eilverfahren schon genauer hinsehen – und notfalls schon in diesem Stadium Maßnahmen aufheben. So geschehen bei der 800-Quadratmeter-Grenze für den Einzelhandel, aber auch mit Blick auf die Behandlung von Zweitwohnungen oder das Verbot, die Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen.
Dass es dabei regional unterschiedliche Praktiken gäbe, läge daran, dass die Gerichte immer noch über Einzelfälle urteilten und die Situation vor Ort im Auge haben müssten: „Deswegen kann es passieren, dass etwa in Bayern mit vielen Corona-Fällen eine bestimmte Maßnahme anders betrachtet wird als etwa in Schleswig-Holstein mit wenig Fällen.“
Seegmüller erklärte, er könne „nur davor warnen, aus den Eilrechtsschutzverfahren und deren Ergebnissen zu schließen, dass alle Eingriffe in Grundrechte gerechtfertigt waren“. Vielmehr müsse die Exekutive eine sorgsame Abwägung über mehrere Stufen vornehmen.
Ausgangssperren gleich wie Inhaftierung behandeln?
Eine Maßnahme müsse nicht nur einen legitimen Zweck verfolgen, wie etwa den Infektionsschutz, sie müsse zudem „geeignet, erforderlich und angemessen sein“, um den Zweck zu erreichen.
So sei bereits im Fall des Alleinsitzens auf einer Parkbank zu bezweifeln, dass diese geeignet sei, das Ziel zu befördern. Die Erforderlichkeitsabwägung habe Fragen zu beantworten wie jene, ob Hygiene- und Abstandsvorschriften als gelindere Mittel nicht ausreichten, um den Zweck zu erfüllen – und eine Ladenschließung dadurch unterbleiben könne. Zudem müsse man die Intensität des Grundrechtseingriffs in Relation setzen zur Minimierung des beabsichtigten Risikos.
Möglicherweise würden die Höchstgerichte sich sogar mit der Frage befassen müssen, ob so weitreichende Ausgangssperren, wie sie über mehrere Wochen in Kraft waren, nicht als „Freiheitsentzug“ gemäß Art. 104 Abs. 2 GG zu werten und unter Richtervorbehalt gestellt werden müssten.
„Öffnungsdiskussionsorgien“ seien der verfassungsmäßig gewollte Zustand
Die Verfassung, so betont Seegmüller, gelte auch in der Krise. Und entgegen der Kritik der Bundeskanzlerin an „Öffnungsdiskussionsorgien“ enthalte das Grundgesetz eine Freiheitsvermutung für den Einzelnen:
Deshalb muss die Exekutive immer in den Blick nehmen, dass der Freiheitsgebrauch die Regel und ihre Einschränkung die Ausnahme ist. Dem Freiheitsgebrauch ist die Inkaufnahme und die Verwirklichung von Risiken immanent.“
Einschränkungen seien zudem selbst dann, wenn sie gerechtfertigt seien, nichts Statisches. Der Staat müsse zu jeder Zeit darlegen, warum Maßnahmen weiterhin gerechtfertigt wären. Deswegen sei er auch nicht frei bei der Gestaltung der Öffnung oder Lockerung.























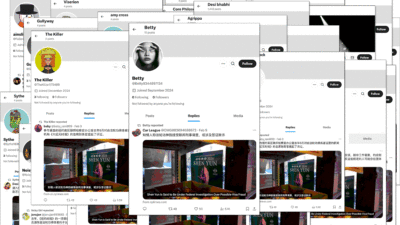







vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion