
RKI-Protokolle: Regierung setzte Ausweitung der Corona-Tests trotz Bedenken durch

Kürzlich veröffentlicht das Robert Koch-Institut (RKI) weitestgehend entschwärzte Protokolle des COVID-19-Krisenstabs für den Zeitraum Januar 2020 bis April 2021. Die Behörde reagierte damit auf eine Klage des Magazins „Multipolar“ auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes und auf eine Zusage von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im März.
Aus den Protokollen geht nun hervor, dass die öffentlichen Empfehlungen der Behörde zu den Corona-Maßnahmen nicht immer evidenzbasiert waren, sondern dass das Bundesgesundheitsministerium offenbar maßgeblich Einfluss nahm.
So hieß es seitens des Krisenstabes am 14. Januar 2020: „[Der SARS-CoV-2]-Infektionsschutz ist ähnlich wie bei SARS oder MERS, aber mit einem geringeren Gefährdungspotenzial.“
Unterscheiden wollte man damals bei der Sicherheitseinstufung zwischen Fällen, bei denen Symptome vorliegen, die klinisch-epidemiologisch aber bislang nicht von einem Labor bestätigt wurden, und Fällen, in denen sich Symptome zeigen, welche sowohl klinisch-epidemiologisch als auch im Labor abgeklärt wurden.
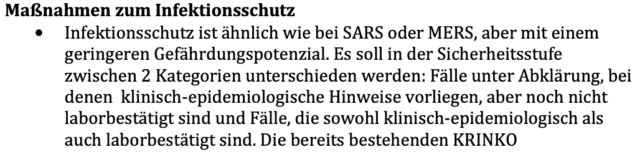
Ausschnitt aus den weitestgehend entschwärzten COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. Foto: Screenshot/RKI-Protokolle
Tatsächlich spielten COVID-19-Symptome im späteren Verlauf der Corona-Krise bei den Empfehlungen zunehmend eine untergeordnete Rolle.
Diskussion um FFP2-Maske
Zunächst schien der Krisenstab kein besonderes Risiko für das medizinische Personal zu sehen. So heißt es im Protokoll vom 14. Januar 2020, dass bislang von den 400 Kontaktpersonen des medizinischen Personals in Wuhan, China, keine bekannte Erkrankung hervorgegangen sei.
Dies erklärten sich die Mitglieder des Krisenstabes damit, dass eine Übertragung gegebenenfalls nur bei längerem engem Kontakt möglich sei, sodass bei Verdachtspersonen unter Abklärung ein einfacher Mund-Nasen-Schutz ausreichen würde. Bei labordiagnostisch bestätigten Fällen empfahl man eine FFP2-Maske.
Später – vermerkt im Protokoll am 11. April 2020 – zeigte sich, dass sich das medizinische Personal und Pflegekräfte in Deutschland oftmals untereinander oder bei privaten Kontakten ansteckte, aber das Anstecken zwischen Patient und Personal nicht die große Rolle spielen würde.
Empfehlung zu FFP2-Maske stößt auf Widerstand
Die Empfehlung des RKI zur FFP2-Maske führte jedoch im medizinischen Bereich zu Diskussionen. In den Protokollen vom 23. März 2020 wird von einem Schreiben der Professorin Petra Gastmeier, Leiterin des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Charité in Berlin, berichtet.
Sie stellt die Empfehlung der Behörde infrage, dass in medizinischen Einrichtungen bei labordiagnostisch bestätigten Fällen eine FFP2-Maske verwendet werden sollte. Darauf heißt es im Protokoll: „Die Diskussion gibt es schon länger, da auch weder die WHO noch das CDC [, die US-Gesundheitsbehörde,] FFP2-Masken bei der Diagnostik von COVID-19 empfehlen.“
Man hatte eine Lösung dafür: Man könne die Empfehlung in der Form anpassen, dass statt von „FFP 2 Masken“ nur von „Atemschutz“ gesprochen werde, heißt es im Protokoll.
Am 28. April 2020 empfahl das RKI dem Personal in Krankenhäusern, Mund-Nasen-Schutz nicht nur im Zusammenhang mit der Behandlung von COVID-Fällen zu tragen, „sondern als generelle Empfehlung“.
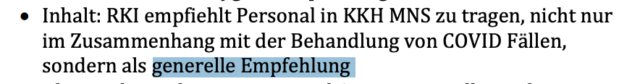
Ausschnitt aus den weitestgehend entschwärzten COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. Foto: Screenshot/RKI-Protokolle
Bundesregierung führt Maskenpflicht ein
Am 29. April 2020 führte die Bundesregierung für ganz Deutschland eine Maskenpflicht bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und beim Einkauf ein.
Ebenso war das regelmäßige Testen beim medizinischen und pflegerischen Personal immer wieder Thema, wobei man sich offenbar selbst beim RKI-Krisenstab nicht einig war. So hieß es am 5. März 2020, dass Testungen bei medizinischem Personal häufiges Thema seien, „HCW [medizinisches Personal] müssten sich theoretisch täglich testen.“
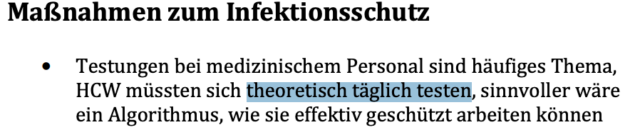
Ausschnitt aus den weitestgehend entschwärtzten COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. Foto: Screenshot/RKI-Protokolle
Ausweitung der Corona-Tests trotz Bedenken
Die RKI-Protokolle zeigen zudem, dass das „Testen von Symptomlosen“ umstritten war. So stand der Krisenstab solchen Tests außerhalb des medizinisch-pflegerischen Bereichs und gefährdeter Gruppen zunächst zurückhaltend gegenüber.
Am 28. April 2020 heißt es im RKI-Protokoll: „Generell schwierigeres Thema bisher ohne Konsens, AG Diagnostik steht aktuell diesbezüglich unter Druck.“ Es gebe noch nicht viel Anhalt für den Mehrwert.
Auch die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Infektionsschutz (AGI) sah die Testung asymptomatischer Fälle „sehr kritisch“. Testergebnisse bei Asymptomatischen seien „schwer zu interpretieren und sollten unbedingt mit anderen Aspekten zur Entscheidung kombiniert werden“.
Man kann nicht alleine auf Testung setzen (z.B. Aufnahme in Einrichtungen).“
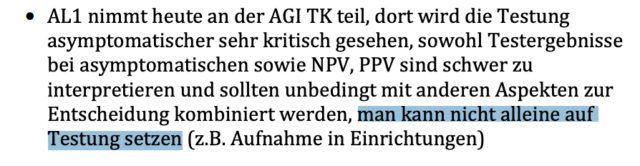
Ausschnitt aus den weitestgehend entschwärzten COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. Foto: Screenshot/RKI-Protokolle
Die Bedenken in den Fachkreisen hielten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht davon ab, Ende April 2020 ein Papier mit dem Titel „Testen, testen, testen“ fertigzustellen. Kern des Papiers war die Ausweitung der Tests bei Symptomlosen.
„Dies ist nur zum Teil mit der Arbeitsgruppe Diagnostik abgestimmt. Kritische Aspekte wie zum Beispiel zur umfangreichen Testung von asymptotischen Personen hat das BMG eingebracht“, heißt es dazu in dem RKI-Protokoll vom 20. April 2020. Dies beinhaltete eine Ausweitung der Testung, vor allem in Pflegeheimen und der Krankenhaushygiene.
Änderungen des Infektionsschutzgesetzes
Die Ampelkoalition brachte Mitte September 2022 Änderungen des Infektionsschutzgesetzes ein, die im Bundestag dann mehrheitlich Zustimmung fand.
Dazu gehörte, dass das Krankenhaus- und Pflegepersonal durchweg eine FFP2-Maske tragen und mindestens sich dreimal pro Woche testen lassen sollte.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) verteidigte die Entscheidung, in der Regel auf FFP2-Masken zu bestehen. Die derzeit kursierenden Varianten seien weniger gefährlich, aber besonders ansteckend. Wenn Masken getragen würden, müssten sie auch wirken. Die Nutzung von FFP2-Masken entspreche dem wissenschaftlichen Sachstand.
Das sahen die Fachexperten der RKI-Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) anders. Sie äußerten scharfe Kritik an den Änderungen.
Den aus ihrer Sicht gebe es „keine ausreichende Evidenz“ […], „dass das dauerhafte Tragen einer FFP2-Maske den Schutz der Patienten und Beschäftigten“ verbessere. Stattdessen halte man einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz für ausreichend.
Zur Begründung werden die hohen Atemwegswiderstände der FFP2-Masken, die dann arbeitsschutzrechtlich notwendigen Maskentragepausen und eine „massive physische Belastung“ gerade bei Pflegepersonal, das schwere körperliche Arbeit verrichtet, aufgeführt.
Ähnlich sieht es dann bei der durch die Bundesregierung angestrebten deutlichen Ausweitung der Corona-Tests aus. So wurde die durch die Regierung eingeführte dreimalige Testung pro Woche für medizinisches Personal ebenfalls durch die KRINKO kritisiert. „Testangebote sollten niedrigschwellig vorhanden sein, aber für die Notwendigkeit einer dreimal wöchentlichen Testung liegt keine Evidenz vor“, so die RKI-Kommission.
Wer finanziert die Tests bei Symptomlosen?
Am 24. April 2020 heißt es dann: „Das größte Problem ist der Umgang mit der Testung asymptomatischer. Ein niederschwelliges, symptombasiertes Testen dient der Frühdiagnose und ist von der KBV [Kassenärztliche Bundesvereinigung] finanziell abgedeckt. Für die Testung Asymptomatischer ist die Finanzierung noch unklar.“
Die Diskussion zieht sich hin. Im RKI-Protokoll vom 13. Mai heißt es dann unter „Diskussion-Teststrategie Vorschlag von Herrn Schaade […]. Während zu Beginn der Epidemie die Testung asymptomatischer Personen nicht empfohlen wurde, so sollen nach Ankündigung von BM Spahn und Anweisung aus dem BMG vom 17.04.2020 auch asymptomatische Kontaktpersonen getestet werden.“
Lars Schaade war damals der RKI-Vizechef.
Auch heißt es nun im Protokoll: „Die Anpassung der Teststrategie ist bei vorhandenen Testkapazitäten grundsätzlich sinnvoll. Die Testung asymptomatischer Kontaktpersonen dient der frühzeitigen Erkennung von Fällen und ist nicht als Freitestung zu verstehen.“
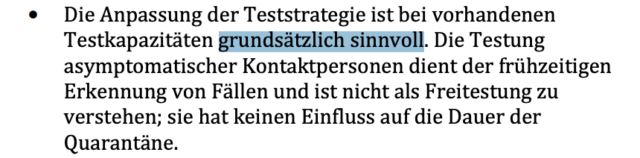
Ausschnitt aus den weitestgehend entschwärzten COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. Foto: Screenshot/RKI-Protokolle
Warum sich die Kassenärztliche Vereinigungen, die Kassen und der öffentliche Gesundheitsdienst bei der Finanzierung der Tests bei Symptomlosen zunächst querstellten, zeigen die Zahlen. Im April 2023 gab das Bundesfinanzministerium bekannt, dass der Bund alleine für Schutzausrüstung, Impfen und Testen zwischen 2020 und 2022 rund 63,5 Milliarden Euro ausgab.
































vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion