
Kulinarisch: Das Comeback der Kartoffel

„Rin in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln“ lautet eine aus dem Plattdeutschen stammende Redewendung, wenn etwas verwirrend abläuft und widersprüchlich ist. In Deutschland wurde die Kartoffel jahrelang als altmodisches Essen verspottet oder war als angeblicher Dickmacher verpönt. Nun erlebt der Erdapfel plötzlich ein kleines Comeback.
Überraschende Rückkehr der Knolle
In Deutschland ist der Pro-Kopf-Verbrauch lange nicht mehr so hoch wie noch etwa in den 50er Jahren, als er bei um die 180 Kilogramm pro Person gelegen haben soll. Jetzt jedoch gibt es eine statistische Überraschung.
„Pro-Kopf-Verbrauch von Kartoffeln erstmals wieder über 60 Kilogramm“, verkündete Ende 2024 die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Sie berief sich aufs Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL).
63,5 Kilogramm im Wirtschaftsjahr 2023/24 (Juli bis Juni) ist vorläufigen Zahlen zufolge der höchste Pro-Kopf-Verbrauch seit zwölf Jahren.
„Im Vergleich zum Vorjahr stieg der rechnerische Verbrauch von Speisefrischkartoffeln um 8,4 Kilogramm pro Person auf 25,5 Kilogramm.“ Der Verbrauch von Erzeugnissen wie Pommes, Kartoffelsalat, Chips sank dagegen um ein Pfund auf 38 Kilo.
Warum werden wieder mehr frische Kartoffeln gegessen?
Weshalb so viel mehr Speisefrischkartoffeln gekauft wurden, ist auch den Experten unklar. BZL-Leiter Josef Goos sagt: „Ein möglicher Grund könnte unter anderem sein, dass durch viele Sonderaktionen des Lebensmitteleinzelhandels, wie kleinere Gebindegrößen, Bürgerinnen und Bürger offenbar häufiger zu Kartoffeln griffen.“
Auch der gestiegene Absatz etwa bei Direktvermarktern auf Bauernhöfen statt in Supermärkten könnte eine Ursache sein.

Frische Kartoffeln an einem Wochenmarktstand in Oldenburg (Niedersachsen). Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Mitte des 18. Jahrhunderts trat die aus den Anden in Südamerika stammende Kartoffel ihren Siegeszug an. Der Preußenkönig Friedrich der Große ordnete in den 1750er Jahren den konsequenten Anbau an (sogenannte Kartoffelbefehle). Als erster Herrscher in Europa erkannte der Alte Fritz, dass das leicht anbaubare Nahrungsmittel die häufigen Hungersnöte verhindern könnte.
„Die Kartoffel ist sehr anpassungsfähig und hat sich an unser Klima und unsere Bodenverhältnisse angepasst“, sagt der Ernährungssoziologe Stefan Wahlen. Hinzu komme die hohe Ertragssicherheit, im direkten Vergleich mit anderen Kohlenhydratlieferanten wie etwa Weizen.
Kartoffeln: Einfach, bodenständig, vielfältig
„Daher war und ist die Kartoffel ein günstiges, nahrhaftes und lagerfähiges Nahrungsmittel. Das hatte zur Folge, dass die Kartoffel von einem fremden Lebensmittel so weit adaptiert wurde, dass sie aktiv in die bestehende Ernährungskultur integriert wurde und sogar zu einem identitätsstiftenden Lebensmittel für die Deutschen wurde“, erklärt Wahlen, der Professor an der Uni Gießen ist.
„Die Kartoffel wird mit Einfachheit und Bodenständigkeit assoziiert. Dabei sollte niemand unterschätzen, dass sie extrem vielseitig ist.“ In Krisen- oder Inflationszeiten könne das erschwingliche Grundnahrungsmittel verschieden zubereitet werden: gekocht, gestampft, gebacken, frittiert, gebraten.
„Die aktuelle Rückbesinnung auf die Kartoffel sehe ich nicht als Zufall“, sagt der Soziologe, „sondern als Ergebnis eines Zusammenspiels von kulinarischen Gewohnheiten der Verbraucher und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung auf der Produktionsseite.“
Die Kartoffel biete sich als ganz praktisch für Verbraucher an, gelte jetzt als preiswert und gesund. (dpa/red)

















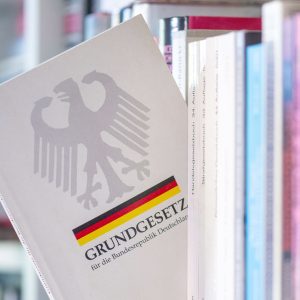

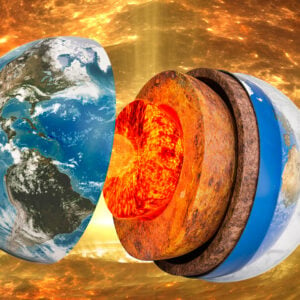










vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion