
Hochwasser – was tun?! Kommunalvertreter fordern Enteignungen für Schutzflächen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) haben am Montag, 3. Juni, gemeinsam Markt Reichertshofen besucht. Der oberbayerische Ort war am Wochenende nach heftigen Regenfällen überflutet worden. Nicht nur die Politiker, auch Vertreter von Kommunen und Verbänden sehen dringenden Gesprächsbedarf über Strategien zur Hochwasservorsorge und -bewältigung.
Veränderungen im Auftreten von Hochwasser
In den vergangenen 20 Jahren stellten durch Hochwasser hervorgerufene Ereignisse 36,5 Prozent aller Naturkatastrophen in Deutschland dar, wie Statista berichtet.
Auch unter der Prämisse, dass heute präzisere Messinstrumente und mehr Daten zur Verfügung stehen, lässt ein wissenschaftlicher Artikel von Forschern der TU Wien aus dem Jahr 2020 einige Trends erkennen. Laut der Autoren seien die vergangen drei Jahrzehnte eine der flutreichsten Phasen der vergangenen 500 Jahre gewesen. Zum anderen unterscheide sich diese Periode von anderen hochwasserreichen Perioden in Bezug auf ihr Ausmaß, die Lufttemperaturen und die saisonale Verteilung der Überschwemmungen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (M. unten), Ministerpräsident Markus Söder (vorne 2. v. l.), Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (M. oben) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (vorne l.) in Reichertshofen. Foto: Sven Hoppe/dpa
Während in früheren Zeiten Hochwasser eher in Kältephasen aufgetreten sei, würden derartige Ereignisse heute immer häufiger in wärmeren vorkommen. Der Anteil der Fluten, die sich im Sommer ereigneten, sei in den vergangenen Jahrhunderten von 41 auf 55 Prozent angestiegen.
Landkreistag fordert weitreichende präventive Maßnahmen
In Deutschland sucht die Politik nach Antworten auf die mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen Klimawandel begünstigte Entwicklung.
Flutgefährdete Städte planen, bestehende Schutzmaßnahmen wie Dämme und Deiche zu verstärken. Dies allein droht jedoch, nicht auszureichen, um stärkeren und häufigeren Ereignissen wie Starkregen und über die Ufer tretende Flüssen gewachsen zu sein.
Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Dirk Sager, fordert in der „Welt“ ein breiteres Portfolio an präventiven Maßnahmen. Dabei sollten ein Umbau von Grundstücken oder Umwidmungen hochwassergefährdeter Flächen keine Tabus darstellen.
Sager bringt die Option ins Spiel, an bestimmten Flüssen Deiche zu verlegen und zusätzliche Überflutungsflächen zu schaffen. Diese sollten einer landwirtschaftlichen Nutzung offenstehen, aber nicht mit Wohn- oder Gewerbeimmobilien bebaut werden dürfen.
Eigentümer wenig kooperationsbereit bei Verkauf von Grundstücken für Hochwasserschutz
Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Uwe Brandl, bringt auch mögliche Enteignungen ins Spiel. Sollte dies zum Hochwasserschutz erforderlich sein, so äußert er gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“, müssten Privateigentümer einem Zwangsverkauf von Grundstücken unterworfen werden können.
Laut der „Welt“ würden zusätzliche Flächen nicht nur gebraucht, um akute Überflutungen abzumildern. Auch perspektivisch sind diese erforderlich, um Vorhaben wie die Rückverlegung von Deichen, die Entsiegelung von Flächen oder das Aufforsten von Wäldern zu erleichtern.

Heftiger Dauerregen hat in Bayern und Baden-Württemberg für Überschwemmungen teils extremen Ausmaßes gesorgt. Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Praxis zeige, dass trotz potenzieller Betroffenheit die Bereitschaft von Eigentümern, ihre Grundstücke zum üblichen Marktpreis abzugeben, nicht immer vorhanden ist.
In Schleiden in der Eifel hätten demnach zwei Drittel der angefragten Eigentümer mit Blick auf die Schaffung eines Rückhaltebeckens das Angebot der Kommune abgelehnt – oder nur zögerlich angenommen.
Nun überlege die Kommune, die Angebote nachzubessern. Man könne zwar auch ein Enteignungsverfahren bei der Bezirksregierung in Köln beantragen, diese wolle jedoch ebenfalls vorerst auf freiwillige Einigungen setzen. Die Hürden für eine Enteignung – wie im Fall des Straßenbaus oder für Eisenbahntrassen – sind hoch. Zudem ist mit Einsprüchen und politischen Widerständen zu rechnen.
Auch die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann, lehnt laut „Welt“ grundsätzliche Verpflichtungen zum Rückbau ab. Sie regt an, die Bebauung von Risikozonen durch eine Anpassung von Bebauungsplänen zu unterbinden.
Union und SPD für Pflicht zur Elementarschadensversicherung – Beschluss jedoch unwahrscheinlich
Aus Union und SPD mehren sich laut „Welt“ unterdessen die Stimmen für eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden. Die Union hat dazu sogar einen Antrag eingebracht, der in dieser Woche im Bundestag debattiert werden soll.
Ob es zu einem Schulterschluss beider Parteien kommen wird, ist ungewiss. Die Differenzen in der Sache erscheinen nicht als unüberbrückbar. Die Sozialdemokraten wollen den Abschluss einer Wohngebäudeversicherung künftig zwingend mit dem Abschluss einer Elementarschadensversicherung verbinden. Die Union will diese Verpflichtung grundsätzlich für das Neugeschäft, allerdings mit einer Opt-Out-Möglichkeit. Wer diese wahrnähme, würde jedoch weder von der Versicherung noch vom Steuerzahler Hilfe zu erwarten haben.
Union und SPD sehen die Versicherungspflicht für Elementarschäden als Weg, um existenzielle Schäden durch Naturkatastrophen zu verhindern. Die FDP lehnt eine solche jedoch ab. Generalsekretär Bijan Djir-Sarai erklärte, Eigentum in Deutschland sei schon jetzt „sehr teuer“. Deshalb erscheint es auch als wenig wahrscheinlich, dass die Sozialdemokraten für dieses Vorhaben aus der Koalition ausscheren.
In potenziellen Hochwasserzonen, die sich mittlerweile recht präzise identifizieren lassen, gilt eine spezielle Gefährdungsklasse. Wer das Risiko versichern will, muss im Regelfall erhebliche Summen aufbringen. Die Pflicht für Gebäudeeigentümer in nicht flutgefährdeten Zonen, Elementarschäden zu versichern, soll, so die Überlegung der Befürworter, die Gesamtsumme erhöhen, die Versicherungsgemeinschaften zur Verfügung haben, um Schäden zu bezahlen.
Allerdings würde eine solche Verpflichtung einer Art Solidaritätszuschlag zugunsten flutgefährdeter Versicherer gleichkommen. Wer diesen verhindern wollte, müsste dann auch auf die Versicherung seines Gebäudes verzichten.

Spuren der Naturgewalt: Ein durch Hochwasser zerstörtes Gebäude an der Wieslauf in Baden-Württemberg. Foto: Marijan Murat/dpa
Etwa 7,6 Prozent der Gebäude permanent durch Hochwasser gefährdet
Laut Statista befinden sich 7,6 Prozent aller deutschen Adressen in Zonen mit hohem statistischem Hochwasserrisiko. Etwa zehn Prozent sind gefährdet, wenn man neben dem Hochwasser auch noch andere durch Starkregen bedingte Risiken einberechnet.
Als Faktoren, die das Risiko von Hochwasser erhöhen, gelten die Bebauung oder Begradigung natürlicher Überschwemmungsgebiete und die Versiegelung von Flächen. Derzeit sind zwei Drittel der Flussauen nicht mehr in ihrem Naturzustand. Fast 30 Prozent aller Fließgewässer gelten als erheblich verändert. Fast acht Prozent der gesamten Fläche des Landes seien zudem versiegelt, sodass Wasser nicht mehr abfließt, sondern sich in Kanalisationen und Wasserläufen sammelt.






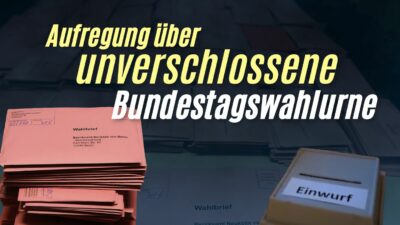















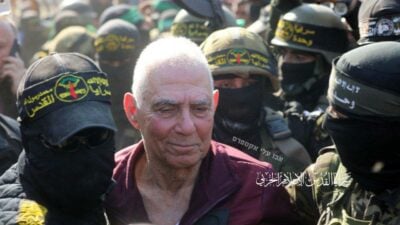








vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion