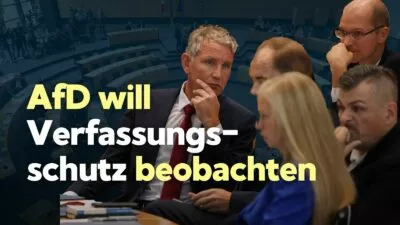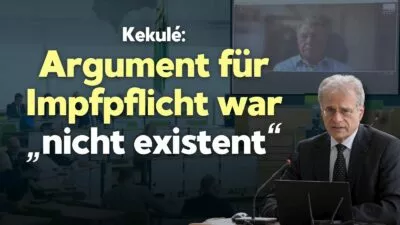Berliner Senat zweifelt an Aussagekraft der PCR-Tests
Schon mehrfach geriet der PCR-Test in die Schlagzeilen. Nun hat auch die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit geäußert, dass PCR-Tests nicht geeignet sind, eine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes abzuleiten. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage des Abgeordneten Marcel Luthe hervor.

Marcel Luthe.
Foto: Epoch Times
Kontaktverbote, Abstand, Quarantäne. Alle Maßnahmen, die derzeit zur Eindämmung des SARS-CoV-2 durchgeführt werden, haben den PCR-Test als Grundlage. Auf seiner Basis wird entschieden, wer als „infiziert“, „infektiös“ oder „krank“ im Sinne des Infektionsschutzgesetzes eingestuft wird.
Am 30. Oktober 2020 erklärte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, dass es sich bei einer Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes um „die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus“ handele.
Gemäß dieser Vorschrift müsse es sich um ein „vermehrungsfähiges Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches transmissibles Agens, das bei Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen kann“ handeln, damit von einem „Krankheitserreger“ gesprochen werden könne.
Auf die Frage des Berliner Abgeordneten Marcel Luthe, ob „ein sogenannter PCR-Test“ in der Lage sei, „zwischen einem ,vermehrungsfähigen‘ und einem ,nicht-vermehrungsfähigen‘ Virus zu unterscheiden“, antwortete der Senat mit einem klaren „Nein“.
Infektionsschutz ohne Grundlage
Aber weshalb stützt dann der Senat seine Überlegungen zum Infektionsschutz auf PCR-Test-Ergebnisse? Die Antwort lautet: „Weil mit dem PCR-Test das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Viren nachgewiesen wird. Das Vorhandensein dieser Viren korreliert mit einer Infektion mit diesen Viren. Diese Infektion ist relevant für die Überlegungen zum Infektionsschutz.“
Insoweit findet es der Senat auch nicht fehlerhaft, aufgrund der übermittelten Testergebnisse von SARS-CoV-2-„Infektionen“ zu sprechen. Gleichzeitig räumt der Senat ein, dass die einer COVID-19-Erkrankung zugeordneten Symptome auch andere Ursachen haben könnten. „Solche differenzialdiagnostischen Betrachtungen sind als Bestandteil der Individualmedizin Aufgabe der behandelnden Ärztin / des behandelnden Arztes“, heißt es in der Antwort weiter.
Die Frage, wie sich der Senat erklärt, dass nur ein relativ kleiner Teil der festgestellten „Infektionen“ zu einer „Krankheit“ im medizinischen Sinne führt und ein Gros der „Infizierten“ nicht krank im vorbezeichneten Sinne sei, beantwortet er ausweichend. Der Senat nehme „zur Kenntnis, dass nur ein Teil der Infizierten erkrankt“ sei. Zudem werde „die epidemiologische Gesamtsituation“ bewertet.
Luthe kritsierte die Antwort des Berliner Senats:
„Da die mit den Verordnungen ergriffenen Maßnahmen nach §§ 28 ff. IfSG der Bekämpfung von Infektionen dienen sollen, die Regierungen aber keinerlei Erkenntnisse über die Entwicklung der Infektionen haben, gibt es für diese Maßnahmen meines Erachtens keine objektive Grundlage, da eine Verhältnismäßigkeit gar nicht beurteilt werden kann – weil wir eben nicht einmal wissen, wie viele ‚Infektionen‘ es gibt und in welchem Masse diese steigen oder sinken.“
Netizen: „Sie stellen stets die richtigen Fragen“
Für sein Engagement erhält der Abgeordnete Dank und Ermutigungen von Facebook-Usern. Einer schreibt:
„Sie stellen stets die richtigen Fragen. Ich wünschte mir, mindestens ein MdB würde dies gegenüber der Bundesregierung auch tun.“
Ein anderer kommentiert:
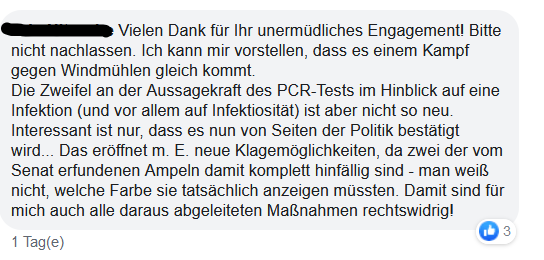
Foto: Screenshot Facebook
Der Medizinrechtler Carlos A. Gebauer führte aus:
Als Medizinrechtler beobachte ich seit Monaten fasziniert, wie der Gesetzgeber mit wachsender Begeisterung das Infektionsschutzgesetz immer wieder ändert, ohne das Gesetz selbst dabei je gelesen zu haben. Natürlich erweist der PCR-Test keine Infektion im Sinne des § 2 IfSG, sondern allenfalls die Möglichkeit einer etwaigen Kontamination, aus der sich – zusammen mit anderen Faktoren wie der Virenlast und der Effektivität individueller Immunreaktionen – eine Infektion ergeben könnte.
Würde man an dieser Stelle juristisch exakt, wissenschaftsmethodologisch präzise und intellektuell redlich agiert haben, wäre jeder seriös denkbare Pandemieverdacht schon irgendwann im April entkräftet gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich aber eine kritische Masse schon so exzessiv in ihre angstlustige Betriebsamkeit gestürzt und entdeckt, wie gut man auf dem Virus-Ticket eigene Agenden durchsetzen kann, dass es kein Halten mehr gab. Nicht ein Virus ist unser Problem, sondern die insuffiziente Rezeption des Narrativs.
Aktuelle Artikel des Autors
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.