
Siebte Gehaltserhöhung in drei Jahren: EU-Beamte verdienen noch mehr

Zum siebenten Mal innerhalb von drei Jahren dürfen sich die 66.000 Beschäftigten der EU-Institutionen über eine Gehaltserhöhung freuen. Seit 2022 wurden die Bezüge von EU-Beschäftigten zweimal im Jahr angepasst. Grund dafür war die massive Inflation. Die Mitarbeiter bekamen jeweils zum 1. Januar und 1. Juli mehr Geld.
Die nunmehrige Erhöhung stellt einen Nachschlag für 2024 dar. Statt um 8,5 Prozent, wie man es angesichts der nach wie vor hohen Inflation zu erwarten gehabt hätte, hob die Kommission die Gehälter lediglich im 7,3 Prozent an. Im April 2025 sollen nun die restlichen 1,2 Prozent folgen.
Zum Grundgehalt für EU-Beamte kommen noch Zulagen
Weniger als 3.645 Euro brutto wird ab April somit kein Beschäftigter mehr in der EU an Grundgehalt einstreichen. EU-Kommissare erhalten künftig 28.400 Euro. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird fortan ein Gehalt von 34.800 Euro monatlich beziehen.
Regelmäßige Anpassungen des Gehalts finden auch je nach Dienstjahren statt. Abhängig von der Familiensituation bestehen noch Ansprüche auf Zulagen für Kinder, Auslandstätigkeit (bis zu 16 Prozent) und Expatriierung oder eine Reisekostenzulage.
Generell berechnen sich die Gehälter für EU-Beamte und deren Anpassungen anhand einer komplexen Formel. Diese berücksichtigt die Inflationsraten im Großraum Brüssel und in Luxemburg ebenso wie die Entwicklung der Gehälter im öffentlichen Dienst der Mitgliedstaaten. Besonders starke inflationäre Entwicklungen wie 2022 ermöglichen Sonderregelungen, um Erhöhungen vorzuziehen oder aufzuteilen. Im Kern geht es um den Ausgleich der Inflation und den Erhalt der Kaufkraft.
EuGH untersagte politisch motivierte Anpassungsbremsen
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte im Jahr 2010 zudem politische Eingriffe in die Automatismen zur Gehaltsanpassung für unzulässig erklärt. Damals stand eine Halbierung der Erhöhung durch den Ministerrat im Raum. Der EuGH forderte hingegen die Einhaltung einer vertraglich festgelegten Methode.
Die EU hält hohe Gehälter, die sich an den Netto-Kaufkraftsteigerungen für nationale Beamte orientieren, für unabdingbar, um Spitzenpersonal nach Brüssel zu bekommen. Inwieweit dies gelingt, ist in den Mitgliedstaaten umstritten. Häufig sind es diese Beamten, die Vorlagen wie jene zur Verordnung für entwaldungsfreie Produkte oder die Plastikmüll-Richtlinie entwerfen, die nicht selten Anlass zu Debatten geben.
Die Mehrkosten für den EU-Haushalt pro Erhöhungsrunde belaufen sich auf etwa 70 Millionen Euro. Sollte die Inflation wieder steigen, könnte dies nicht die letzte Erhöhung im Jahr 2025 gewesen sein.
Eigeninteresse von Entscheidungsträgern an hoher Inflation?
Insgesamt erfolgt die Hälfte der Anpassungen aufgrund der von Eurostat jährlich von Juli zu Juli berechneten Netto-Kaufkraftentwicklung. Die andere Hälfte ist an der Preisentwicklung an den Hauptstandorten der EU-Institutionen orientiert – wozu Brüssel und Luxemburg zählen, nicht aber Straßburg. Liegt die Inflation dort über mehr als sechs Monate hinweg höher als drei Prozent, greift die Sonderanpassung.
Anders als auf nationaler Ebene gibt es auf EU-Ebene keine Tarifverhandlungen. Kritik entzündet sich an den verzögerten Anpassungen und überproportionale Erhöhungen in Krisenzeiten. Immerhin werden historische Daten genutzt. Im Jahr steigen die Gehälter trotz gesunkener Inflation weiter, weil die Berechnung auf den Daten von 2024 basiert.
Der Gedanke, dass EU-Beamte aufgrund des Anpassungssystems ein Eigeninteresse an hoher Inflation haben könnten, greift dennoch zu kurz. Theoretisch profitieren die Beamten zwar von hohen Preisen. Das System ist aber zu komplex, um politische Manipulation zu erleichtern. So dauert es bis zu 18 Monate, bis die Effekte der Anpassung greifen.
EU-Beamte bezahlen keine nationale Einkommenssteuer
Dazu kommt die Zwei-Prozent-Vorgabe der Europäischen Zentralbank (EZB) im Bereich der Inflation. Auf politische Einflussnahmen oder ein dauerhaftes Verfehlen dieses Ziels reagieren die Märkte allergisch – abgesehen von den zu befürchtenden politischen Folgen dauerhaft hoher Teuerung.
EU-Beamte unterliegen auch einer Sondersteuer. Diese beträgt bis zu 45 Prozent. Im Gegenzug sind sie von der Entrichtung nationaler Steuern befreit. Dies gilt jedoch nur für Bezüge aus der laufenden Tätigkeit für die EU. Einkünfte im Rahmen der anderen Einkunftsarten, z. B. aus Vermietung oder Verpachtung, unterliegen weiter der nationalen Einkommenssteuer.

























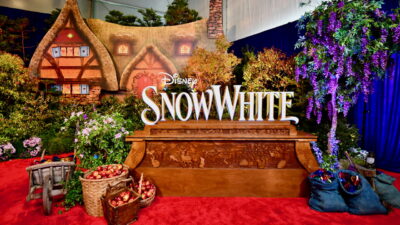





vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion