
Etwa drei Millionen Ukrainer arbeiten in Russland – und hadern mit Restriktionen gegen Geldtransferdienste

Kritiker hatten bereits in den Tagen der geplanten Unterzeichnung des EU-Assoziationsabkommens und der Unruhen auf dem Kiewer Maidan davor gewarnt, die Ukraine vor eine Zerreißprobe zu stellen. Man hatte nicht auf sie gehört, und die Folgen sind bekannt: Es kam zu einem gewaltsamen Umsturz, die Krim erklärte ihre Abspaltung, im Donbass entbrannte ein Krieg zwischen prorussischen Aufständischen und der Zentralregierung, die Korruption blieb dem Land auch ohne Wiktor Janukowytsch erhalten, die Wirtschaft ist weiterhin schwer angeschlagen und die Löhne sind die geringsten in ganz Europa.
Die Hoffnungen auf einen schnellen Zugang zum europäischen Markt haben sich bislang für die Ukrainer nicht erfüllt. Zwar dürfen diese mittlerweile für bis zu 90 Tagen visafrei in die EU einreisen, eine Arbeitserlaubnis ist damit jedoch nicht verbunden. Dem in Kiew ansässigen Zentrum für wirtschaftliche Strategie zufolge haben in den Jahren 2015 bis 2017 etwa vier Millionen Ukrainer ihr Land verlassen, um Arbeit zu suchen, ein Drittel davon als Saisonarbeiter.
Lange Zeit war Polen das Hauptziel ukrainischer Arbeitsmigration, mittlerweile ist es – allen politischen und diplomatischen Verwicklungen zum Trotz – wieder die Russische Föderation. Dies trotz des Krieges im Donbass und der Tatsache, dass es seit 2015 nicht einmal mehr Flugverkehr zwischen beiden Ländern gibt. Etwa drei Millionen Ukrainer arbeiten der „Kyiv Post“ zufolge in Russland und offenbar nicht einmal zu schlechten Bedingungen.
Neun Prozent des Bruttoinlandsprodukts kommen von ukrainischen Expats
Insgesamt sollen die ukrainischen Arbeiter von Russland aus Jahr für Jahr mehr als eine Milliarde US-Dollar zu ihren Familien in die Heimat schicken. Der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin erklärt den Drang seiner Landsleute nach Russland nicht zuletzt mit dem Fehlen einer Sprachbarriere.
Der ukrainischen Nationalbank zufolge sollen im Ausland arbeitende Ukrainer im Vorjahr insgesamt 9,3 Milliarden US-Dollar in ihre Heimat transferiert haben, was etwa neun Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspreche. Für 2018 werden mehr als elf Milliarden erwartet.
Die politischen Verwicklungen sorgen unterdessen für immer mehr Schikanen gegenüber Ukrainern, die in Russland arbeiten. Die Regierung in Kiew hat Sanktionen gegen russische Banken verhängt und russische Geldtransfersysteme verboten. Russland hat im Gegenzug Maßnahmen erlassen, um bestimmten Geldtransferdiensten die Arbeit zu erschweren. Der Geldfluss durch inoffizielle Kanäle wird dadurch weiter angestachelt.
Der Statistik der ukrainischen Nationalbank NBU zufolge seien 2017 offiziell insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar aus Russland in die Ukraine geflossen, die reale Summe könnte bis zu dreimal so hoch sein, da viele Kurzzeitarbeiter ihre Saläre in bar über die Grenze brächten oder andere inoffizielle Kanäle nutzen. Das ukrainische Verbot von gleich sieben russischen Geldtransferdiensten, Blizko, Anelik, Zolotaya Korona, Leader, Unistream, Colibri und Contact, habe zu dieser Diskrepanz beigetragen. Bis Oktober 2016 wurde fast die Hälfte aller Transfers über diese Anbieter abgewickelt. Auch das in Großbritannien registrierte System MoneyTo ist betroffen, da der russisch-britische Unternehmer George Piskow als Mitgründer von Unistream in Ungnade gefallen ist.
Betroffene weichen auch inoffizielle und halblegale Wege aus
Auch die Webdienste WebMoney, Yandex Money und Qiwi sind betroffen. Es wird gemunkelt, dass eine erfolgreiche Lobbyarbeit des US-Transferriesen Western Union zu der Verbannung der russischen Anbieter beigetragen hat. Russland hat seinerseits in Reaktion darauf das Höchstlimit für Transfers via Western Union und Moneygram gesenkt.
Die Schikanen für den Normalbürger, die mit dem politischen Geplänkel verbunden sind, veranlassen immer mehr Betroffene, nach kreativen Auswegen zu suchen. Einige davon sind umständlich und teuer.
Eine normale Überweisung von einem russischen auf ein ukrainisches Konto über das SWIFT-Zahlungssystem kostet umgerechnet mindestens 20 US-Dollar. Wer bei einer russischen Bank ein Konto eröffnet und von dort aus über Western Union oder Moneygram versendet, bezahlt etwa ein Prozent an Kommissionsgebühren. Eine Sendung über einen Postanbieter ist gleich mit fünf Prozent Gebühren verbunden. Maryna Revutska von der Oschadbank erklärt gegenüber der „Kyiv Post“, die durchschnittliche Höhe einer Schecküberweisung von Russland in die Ukraine betrage 400 bis 450 US-Dollar, in der Gegenrichtung etwa 200:
„Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass das hauptsächlich unsere ‚Sarobitschani‘ [ukrainische Gastarbeiter] sind, die Geld nach Hause zu ihren Familien schicken. Nicht alle von ihnen sind bereit, ultra-moderne Kanäle zu nutzen, sie brauchen legale, sichere und günstige Wege.“
Russische Banken verlassen die Ukraine
Ein beliebter Ausweg sind sogenannte Transferagenten wie Busfahrer oder Lokführer, die gegen ein geringes Zusatzentgelt Umschläge mit Geld für die jeweiligen Empfänger auf die Reise mitnehmen. Ein anderer ist es, ein Konto bei einer russischen Bank mit Niederlassungen in der Ukraine zu unterhalten und dortige Verwandte gebührenfrei mit Karte das Geld abheben zu lassen. Auf Grund von Sanktionen durch die ukrainische Regierung und Vandalenakten radikaler Nationalisten ziehen sich jedoch immer mehr davon aus dem Land zurück.
Seit dem Verbot russischer Transfersysteme ist die Gesamtsumme, die über internationale Dienste verschickt wird, von 811 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 444 Millionen im Vorjahr gesunken. Hingegen verdoppelte sich die „informell“ verschickte Summe zwischen 2015 und 2018 von 680 Millionen US-Dollar auf 1,3 Milliarden.
Über die harschen Restriktionen gegenüber russischen Transferanbietern sind unterdessen auch bereits Vermittlerdienste wie TYME gestolpert. Dieses Transfersystem hat im Juni seine Lizenz verloren, nachdem der ukrainische Geheimdienst herausgefunden haben will, dass TYME mit dem verbotenen russischen System Contact zusammengearbeitet haben soll. Für die wenigen übrigen einheimischen Dienste wie Welsend, Ria, Meest, Khazri und Intel Express eine Warnung.
„Der Sektor des Geldtransfers ist in ständigem Wandel“, erklärte Wladimir Goriatschew, ein Betroffener, der „Kyiv Post“. Was gestern noch möglich gewesen wäre, könne schon morgen illegal sein.
Card-to-Card als Option
Eine weitere mögliche Option zu sicherem und bezahlbarem Geldtransfer bieten auch ukrainische Banken an, die Geldtransfer von einer Bankkarte zur anderen erlauben – etwa von Visa-, Mastercard- oder Maestro-Karten, die russische Banken ausgestellt hatten, auf solche ukrainischer Geldhäuser.
Dazu kommen einige Internetdienste wie Paysend.com oder Send2UA.com, zusätzlich zu einigen wenigen einheimischen ukrainischen Alternativen wie iPay.ua oder LiqPay, die ebenfalls Card-to-Card-Transfers anbieten.
Ein Hoffnungsmarkt für Transferdienste, die mit ukrainischen Kunden zusammenarbeiten, bietet hingegen die zunehmende Arbeitsmigration in Länder wie die USA, Israel und jene der EU wie Polen, Ungarn, Litauen, Deutschland oder Dänemark. Hier wittern neue Dienste wie TransferGo oder TransferWise ihre Chancen. Von dort aus schicken derzeit etwa 70 000 Ukrainer regelmäßig Geld. Im Schnitt 200 Euro pro Transfer. Innerhalb von acht Monaten habe die Gesamttransaktionssumme sich gegenüber dem Vorjahr vervierfacht, meint Anastasia Fomenko von TransferGo gegenüber der „Kyiv Post“.


















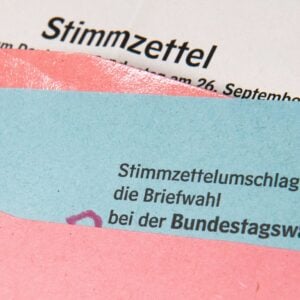












vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion