
Berlin sieht Pläne für Asyl-Krisenverordnung kritisch: Ausnahmen klarer regeln

Bei den Verhandlungen zur geplanten Reform der EU-Asylpolitik bahnt sich neuer Streit an. Im Zentrum der Kontroverse steht eine Verordnung, die es überlasteten Mitgliedstaaten erlauben würde, geltende Standards für die Registrierung und Unterbringung von Asylsuchenden in Ausnahmesituationen abzusenken.
Die Bundesregierung sieht den Vorschlag, zu dem die spanische EU-Ratspräsidentschaft bis zum Monatsende eine Einigung herbeiführen will, kritisch. „Der Verordnungsvorschlag steht noch unter Prüfvorbehalt innerhalb der Bundesregierung“, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums dpa auf Anfrage mit.
Ausnahmen klarer regeln
Deutschland soll bei den Verhandlungen zur Krisenverordnung dem Vernehmen nach gefordert haben, dass die Voraussetzungen für die Anwendung der Ausnahmevorschriften durch einen EU-Mitgliedstaat präziser als bislang vorgesehen gefasst werden müssten.
Polen und Ungarn, die bereits die Beschlüsse des Rates vom 8. Juni kritisiert hatten, haben ebenfalls Bedenken vorgebracht. Allerdings aus anderen Gründen: Ihnen gehen die Vorschriften nicht weit genug.
Der EU-Plan sieht die Verpflichtung der Mitgliedstaaten vor, entweder Migranten und Flüchtlinge in ihrem Hoheitsgebiet aufzunehmen (bis zu 30.000 pro Jahr) oder 20.000 Euro für jeden abgelehnten illegalen Migranten zu zahlen.
Bei der Migrationspolitik ist die EU in einen östlichen und einen westlichen Flügel gespalten. Die Hauptgegner des neuen Migrationspaketes sind Ungarn und Polen. Beide Länder fordern Einstimmigkeit in dieser Frage, um ihr Vetorecht ausüben zu können. Sie sind sich auch einig, dass das neue Brüsseler Paket im Grunde eine „Einladung an Migranten“ sei.
Prüfungen an den EU-Außengrenzen
Die EU-Innenminister hatten am 8. Juni mit einer ausreichend großen Mehrheit für umfassende Reformpläne gestimmt. Asylanträge von Migranten aus Herkunftsländern mit einer Anerkennungsquote von weniger als 20 Prozent sollen danach bereits an den EU-Außengrenzen innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden.
In dieser Zeit will man die Schutzsuchenden verpflichten, in kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen zu bleiben. Wer keine Chance auf Asyl hat, soll umgehend zurückgeschickt werden.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sich in den Verhandlungen dafür eingesetzt, dass Familien mit Kindern von den sogenannten Grenzverfahren ausgenommen werden. Um den Durchbruch zu ermöglichen, musste die Bundesregierung akzeptieren, dass dies doch möglich sein könnte.
Was steht in dem Vorschlag?
Der Vorschlag für die neue Krisenverordnung sieht unter anderem längere Fristen für die Registrierung von Asylgesuchen an den Außengrenzen vor, außerdem die Möglichkeit der Absenkung von Standards bei der Unterbringung und Versorgung.
Zudem sollen Schutzsuchende in Krisen-Situationen nach den Vorstellungen des Rates verpflichtet werden können, sich länger als zwölf Wochen in den Aufnahmeeinrichtungen in Grenznähe aufzuhalten. Als Krisensituation soll beispielsweise eine Lage gelten, in der ein anderes Land Geflüchtete „instrumentalisiert“, so wie zuletzt an der belarussisch-polnischen Grenze.
„Da sich die Bundesregierung bei der Abstimmung über die sogenannte Instrumentalisierungs-Verordnung im Dezember 2022 enthalten hatte, blickt sie insbesondere kritisch auf die Regelungen zu Instrumentalisierungssituationen, die in der Krisenverordnung enthalten sind“, hieß es aus dem Bundesinnenministerium. Die Bundesregierung möchte Standards für Schutzsuchende verbessern und ein für die Mitgliedstaaten einheitliches, handhabbares Verfahren in Krisensituationen zu erreichen.
„Die Innenministerin hat erst vor kurzem den problematischen Grenzverfahren und damit der Inhaftierung von Kindern und Familien zugestimmt“, sagte der Grünen-Innenpolitiker Julian Pahlke. Er befürchte, dass die Grenzverfahren, wenn eine Krise ausgerufen werde, „praktisch für so gut wie alle Geflüchteten angewendet werden“ könnten. „Durch die Krisenverordnung droht es, zu mehr Pushbacks, bis zu zehnmonatiger Haft und einer weiteren Entrechtung von schutzsuchenden Menschen zu kommen“, warnte Pahlke.
Pro Asyl nannte die geplante Verordnung einen „Blankocheck für Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen“ der Europäischen Union.
Welche Bedenken gibt es aus den EU-Ländern?
Spanien, das Anfang Juli die Ratspräsidentschaft übernommen hat, bemüht sich laut Bundesinnenministerium, zeitnah eine Einigung des Rates zur Krisenverordnung zu erreichen. Ein Sprecher verwies darauf, dass auch das Europäische Parlament deutliche Fortschritte des Rates bei diesem Rechtsakt erwarte.
Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurde nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) für rund 150.000 Menschen erstmalig ein Asylantrag in Deutschland gestellt. Das waren rund 77 Prozent mehr Erstanträge als im Vorjahreszeitraum. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erhalten gemäß einer EU-Richtlinie Schutz und müssen daher keinen Asylantrag stellen. (dpa/red)





















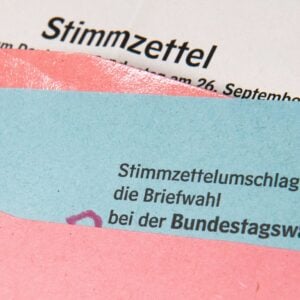










vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion