
16 Minister auf der Suche nach Abschiebemöglichkeiten für straffällige Afghanen und Syrer

Kommt allmählich Bewegung in die seit Jahren andauernde Debatte um Abschiebungen von ausländischen Straftätern? Ab Mittwochnachmittag kommen die Innenminister der 16 Bundesländer in Potsdam zusammen, um unter anderem über Möglichkeiten zu sprechen, islamistische Gefährder und afghanische oder syrische Schwerkriminelle aus Deutschland zu schaffen. Am Freitag, 21. Juni, sollen die Ergebnisse vorgestellt werden.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte angekündigt, auf der Innenministerkonferenz (IMK) einen neuen Gesetzentwurf mit entsprechenden Lösungen vorlegen zu wollen. Die Juristen des Bundesinnenministeriums (BMI) standen dabei vor einer komplexen Aufgabe. Ob diese gemeistert wurde, wird ihr Entwurf zeigen. Nach Einschätzung des Völkerrechtsprofessors Daniel Thym herrscht bei den internationalen Rechtsvorschriften jedenfalls eine „verwirrende Gemengelage“, die stets den Blick auf den Einzelfall erforderlich mache.
Sicherheitsinteresse des Gastgeberlandes irrelevant
Entscheidend sei neben dem Asyl- beziehungsweise Flüchtlingsstatus grundsätzlich immer die Lage im Heimatland eines Asylsuchenden, nicht aber sein Verhalten oder das Sicherheitsinteresse des Gastgeberlandes, erläuterte Thym jüngst in einem Artikel für den „Verfassungsblog“. Die angebliche „Priorität“ des deutschen Sicherheitsinteresses, wie sie von Politikern gerne im Mund geführt werde, spiele in Wahrheit keine Rolle. Sogar „Terroristen und schlimmste Straftäter“ könnten de facto nicht abgeschoben werden, falls ihnen in der Heimat „Folter oder schlimme Haftbedingungen“ drohten. Sie unterlägen dann höchstens dem Strafrecht ihres Gastlandes.
Ausnahmen existierten gemäß Paragraf 60 (8) des Aufenthaltsgesetzes lediglich nach Verbüßung von Freiheitsstrafen bestimmter Dauer aufgrund bestimmter Vergehen oder Verbrechen. Auch die Genfer Flüchtlingskonvention lasse per Artikel 33 (2) eine Ausweisung zu, wenn ein Flüchtling „aus schwer wiegenden Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit des Landes anzusehen ist, in dem er sich befindet, oder der eine Gefahr für die Allgemeinheit dieses Staates bedeutet, weil er wegen eines Verbrechens oder eines besonders schweren Vergehens rechtskräftig verurteilt wurde“.
Innerhalb Europas aber existiere auf Grundlage des Artikels 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention „ein höheres Schutzniveau“, das eine Abschiebung verbiete. „Diese verwirrende Gemengelage führt immer wieder zu Missverständnissen“, konstatiert Thym.
Schutzstatus oft unüberwindbare Hürde
Schon bei Gewährung des „subsidiären Schutzes“ wie im Fall der meisten Syrer oder bei Abschiebungsverboten wie im Fall Afghanistans seien die Betroffenen jedenfalls „juristisch zu 100 % vor einer Abschiebung“ geschützt, selbst wenn vor Ort nicht mehr überall Gefahren für Rückkehrende beständen. Auch die Gefahr vor Armut und Hunger im Heimatland oder der persönliche Gesundheitszustand könnten juristisch eine Rolle spielen.
Wie also abschieben? Nach Auffassung von Thym liegt es nun „im Kern“ am Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), „darüber zu entscheiden, ob weiterhin alle Syrer und Afghanen gleichzeitig automatisch Schutz bekommen sollen“ – oder ob man nicht doch besser jeden Einzelfall prüft. Im Fall einer Ablehnung sei dann das Auswärtige Amt mit seinen diplomatischen Beziehungen gefragt, praktische Lösungen zu finden.
Faeser führt bereits „vertrauliche Gespräche“ mit Nachbarländern
Jahrelang hatte die Bundesrepublik generell auf Abschiebungen nach Afghanistan oder Syrien verzichtet. Zuletzt aber hatten sich sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als auch BMI-Chefin Faeser offen für Veränderungen in der Rückführungspraxis gezeigt. Man prüfe schon seit Monaten die Rechtslage und erste vertrauliche Gespräche mit Nachbarländern von Afghanistan und Syrien liefen ebenfalls, hatte Faeser in den vergangenen Tagen immer wieder erklärt.
Auslöser für den Sinneswandel war das Messerattentat vom 31. Mai 2024, in dessen Folge ein Polizist in Mannheim gestorben war. Auch der Fall des afghanischen Messerstechers von Wolmirstedt hatte das Thema angeheizt.
Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU), Gastgeber und Vorsitzender der Innenministerkonferenz (IMK), zeigte sich wie der Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel bereits offen dafür, drei Jahre nach dem Abzug der NATO aus Afghanistan endlich Gespräche mit den dort herrschenden Taliban aufzunehmen. Wie sein Hamburger Kollege Andy Grote (SPD) würde auch Stübgen Abschiebungen nach Syrien unterstützen. Dort habe sich die Situation geändert, es gebe keinen Krieg mehr, sagte Stübgen am Mittwochvormittag im rbb. Die Bundesregierung müsse nun endlich handeln.
Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) würde eine Abschiebelösung für Afghanistan unter Einbeziehung seiner Nachbarländer bevorzugen, wie er vor zwei Wochen im Interview mit dem „Deutschlandfunk“ klargestellt hatte. Nach Angaben der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ bestätigte BMI-Chefin Faeser kürzlich Kontakte zu Usbekistan.
AfD- und CDU-Oppositionelle bezweifeln echten Willen
Stefan Keuter, der Obmann der AfD-Bundestagsfraktion im 1. Untersuchungsausschuss „Afghanistan“, hatte vor wenigen Tagen in einer Pressemitteilung erklärt, dass er nicht wirklich den Willen zur Rückführung von Migranten nach Afghanistan erkennen könne. Die Befragung eines namentlich nicht genannten Zeugen aus dem BMI habe am 13. Juni zutage gebracht, „dass Rückführungen von kriminellen Afghanen aus Deutschland mit der Begründung möglicher Verelendung in der Heimat gestoppt wurden“.
Sein Parteikollege Karsten Woldeit, der innenpolitische Sprecher der Berliner AfD-Fraktion, hält die ganze Diskussion nach einem Bericht der „Berliner Zeitung“ für eine Scheindebatte: Zahlen der Senatsinnenverwaltung belegten, dass bereits nach Afghanistan abgeschoben werde. Er geht auch davon aus, dass hinter den Kulissen mit den Taliban geredet würde: „Wenn 380 Millionen Entwicklungshilfe nach Afghanistan fließen, muss es Gespräche mit den Taliban seitens der Regierung geben. Und der Umstand, dass es Abschiebungen in das Land gibt, unterstreicht meine Einschätzung“, so Woldeit. Nach Angaben der „Berliner Zeitung“ wurden allein aus Berlin im laufenden Jahr bereits sieben Personen in Richtung Afghanistan abgeschoben.
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte vor wenigen Tagen vorgeschlagen, nach Schweden zu fliegen und sich erklären zu lassen, wie dort die Abschiebungen nach Afghanistan gelungen seien. Davon abgesehen sei er überzeugt, dass es „Kanäle“ gebe, über die man mit den Taliban reden könne. Es müsse nur politisch gewollt sein.
Offiziell keine diplomatischen Beziehungen – trotz andauernder Rettungsanstrengungen
Das Auswärtige Amt wehrt sich wie der Rest der Bundesregierung schon länger dagegen, offiziell diplomatische Beziehungen zu den Taliban aufzubauen. „Wie unsere europäischen Partner haben wir keine Botschaft vor Ort, die die Rückführungen begleiten könnte“, hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Anfang Juni zu Protokoll gegeben. Es gebe bei Abschiebungen auch keine Begleitung der Bundespolizei mehr, weil der frühere BMI-Chef Horst Seehofer (CSU) diese Praxis aus Sicherheitsgründen eingestellt habe.
Andererseits bemüht sich Baerbock nach Informationen der Funke Mediengruppe weiter um die Rettung von weiteren 10.000 besonders gefährdeter „Ortskräfte“ aus Afghanistan. Hochrangige Sozialdemokraten hatten sich Anfang Juni noch einmal für mehr Zuwanderung eingesetzt.
Zieschang: Auch an Ägypten, Elfenbeinküste und Gambia denken
Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) verlangt im Widerspruch zum Standpunkt von Außenministerin Baerbock ein sofortiges Ende des Bundesaufnahmeprogramms für gefährdete Afghanen. Auch die Bemühungen „um Migrationsabkommen mit den für Rückführung wirklich bedeutsamen Herkunftsländern wie zum Beispiel Ägypten, Elfenbeinküste, Gambia“ verlaufen ihrer Meinung nach zu zögerlich, wie der „Tagesspiegel“ berichtet.
Vonseiten der Taliban liegt übrigens bereits ein offizielles Angebot des außenpolitischen Sprechers Abdul Kahar Balchi vor, die Frage „im Rahmen der üblichen konsularischen Beziehungen und eines geeigneten Mechanismus auf der Grundlage einer bilateralen Vereinbarung zu regeln“. Christian Rath, der rechtspolitische Korrespondent der taz, geht allerdings davon aus, dass Deutschland sich „außenpolitisch isolieren“ würde, sobald es offiziell mit den Taliban verhandeln würde.
Verschiedene Flüchtlingsinitiativen kündigten für die Potsdamer IMK bereits Protestveranstaltungen an. Die Hilfsorganisation Pro Asyl etwa hält Abschiebungen nach Afghanistan oder Syrien von vorneherein für menschenrechtswidrig.
Weitere Themen der IMK
Bei der IMK stehen darüber hinaus noch weitere Themen auf der Tagesordnung: Es soll um Verschärfungen des Waffen- und Strafrechts und um einen besseren Bevölkerungsschutz angesichts des Ukraine-Krieges gehen.
Gastgeber Stübgen will nach Informationen des rbb auch die Frage klären lassen, wie Deutschland mit wehrpflichtigen Ukrainern umgehen soll, die sich derzeit im Bundesgebiet aufhalten. Zum einen kämen viele ukrainische Männer ihrer Pflicht nicht nach, ihren Wehrstatus persönlich in ihrer Heimat klären zu lassen. Zum anderen ließen sich viele Ukrainer lieber Bürgergeld auszahlen, anstatt sich um eine Beschäftigung zu bemühen.












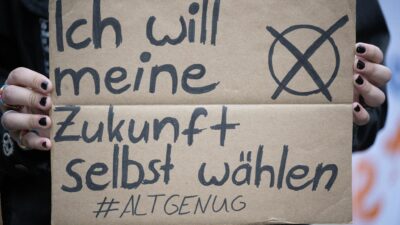















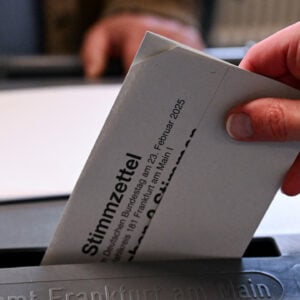









vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion