
Einst Kriegsschauplatz, heute ein Ort der Begegnung und Freundschaft

Im Grenzgebiet an der Oder, zwischen Polen und Deutschland, fanden die letzten grausamen und verlustreichen Schlachten zwischen der Roten Armee, polnischen Streitkräften und der Wehrmacht statt. Wer heute diese Gebiete erkundet, sei es beim Wandern oder bei langen Radtouren, wird sich der Geschichte bewusst, die für immer diese beiden Länder prägen wird.
Eine oftmals noch unentdeckte Natur bietet dem Besucher heute in Friedenszeiten Erholung und viele Geschichten, die sich zwischen diesen beiden Ländern ereigneten.

Foto: Sabine Küster-Reeck
„Schöne Brücke hast mich oft getragen. Wenn mein Herz erwartungsvoll geschlagen und mit Dir den Strom ich überschritt. Und mich dünkte, deine stolzen Bogen sind in kühneren Schwüngen mitgezogen und sie fühlten meine Liebe mit.“ (Gottfried Keller, schweizerischer Dichter und Schriftsteller)
Verbindender Stahl über Wasserstrudeln
Fast ein wenig unnahbar wirkt sie in ihrer grauen, erhabenen Eleganz; will scheinbar kein Ende nehmen, lockt den Wanderer, immer weiter und weiter zu gehen. Neugier und Entdeckergeist erfassen ihren Besucher unwillkürlich.
Unter ihr, schnell und mit vielen Strudeln, fließt die Oder, Deutschlands östlichster und geschichtsträchtiger Fluss. Sie entspringt in Tschechien und bildet seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Grenze zwischen Deutschland und Polen.
Eine hohe Aussichtsplattform macht es möglich, den Blick über die unendlichen Flussauen schweifen zu lassen. Einerlei zu welcher Jahreszeit, der Ausblick ist wunderschön. Auf der deutschen Seite noch Ebene, zur polnischen Seite bewaldete Hügellandschaft.
Sogar jetzt, in der kalten Jahreszeit, kann man viele Wasservögel beobachten. Kraniche, die in China Glück symbolisieren, rasten hier, suchen nach Nahrung, auch im Winter. Der seltene Singschwan fühlt sich in den weitläufigen Auen nahe der Europabrücke zuhause.
Wandert man ausgehend vom winzigen Ort Bienenwerder in Richtung Europabrücke; so ist schon der Himmel bemerkenswert. Mal tiefschwarze Wolken, dann bereits wärmende Sonnenstrahlen, die fast blenden. Der starke Wind zerzaust die Haare und man ist gut beraten, sich in warme Jacken zu hüllen.
Und da ist sie dann plötzlich. Hinter altem Baumbestand taucht sie über dem Deich auf. Ein Stahlgebilde, das unendlich erscheint. Etwa 700 Meter ist sie lang. Trutzig liegen noch immer rechts und links von ihr im lebhaften Wasser die mächtigen alten Fundamente der ursprünglichen Brücke, die als Eisenbahnbrücke konzipiert war. Sie war die Basis für die heutige Europabrücke.
Bewachsen sind die Pfeiler inzwischen mit Birken oder Weiden, die es sich in den Rissen der alten Gemäuer bequem gemacht haben. Wäre es nicht so kalt, könnte man lange ausharren, um die Strudel zu betrachten, die lebhaft um die Pfeiler kreisen. Hineinfallen möchte man da nicht. Eine Brücke über bewegten Wassern. Im wahren, wie im übertragenen Sinne.

Foto: Sabine Küster-Reeck

Europabrücke mit Aussichtsplattform. Foto: Sabine Küster-Reeck
Spotkania – Ein Ort der Begegnung
Die Europabrücke hat einen ebenso dramatischen Hintergrund, wie auch die Geschichte der beiden Länder, die sie nun ohne Grenzkontrolle verbindet. Einfach waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen nie. Kriege, Teilungen und Ressentiments bestimmten lange die Situation zwischen beiden Völkern.
Eine Brücke der Verständigung im Osten Europas soll sie nun sein. Und ob man sie nun von deutscher oder polnischer Seite aus überquert: Menschen beider Länder begegnen sich in ihrer Mitte und grüßen einander freundlich und respektvoll. Man lächelt sich zu.
„Spotkania“, die Begegnung, wie es auf Polnisch heißt. Gegenseitige Offenheit, Neugier ist da. Radler und Wanderer radebrechen miteinander, so gut es geht. Vor allem aber: Freundliche, zugewandte Gesichter.
Die Geschichte der Europabrücke
Die einstige Eisenbahnbrücke über die Oder war über Jahrzehnte gesperrt. 1892 eröffnet, führte sie von Wriezen nach Godkóv, dem damaligen Jädickendorf. Sie verband damit Berlin mit der Neumark.
1930 dann, wurde wegen des hohen Verkehrsaufkommens eine neue Bahnbrücke gebaut und der vorhandene Teil zur Straßenbrücke umfunktioniert. Beide Brücken wurden 1945 gesprengt.
Die Deutsche Reichsbahn begann in den 1950er Jahren mit dem Wiederaufbau der jüngeren der beiden Brücken. Hintergrund waren strategische Konzeptionen der Warschauer Vertragsstaaten. Sie wurde auch bis 1989 nur zu militärischen Zwecken genutzt.
Nach der Wende wurde die Brücke gesperrt und 30 Jahre lang nicht genutzt. Im Herbst 2022 wurde die Brücke dann offiziell als Rad- und Wanderbrücke vom Brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und seinem polnische Kollegen, Olgierd Geblewicz, eröffnet.
Ehrung für einen besonderen Menschen: Władysław Bartoszewski
Noch heute ist der Politiker und Publizist Władysław Bartoszewski in Polen eine moralische Instanz. Der Mann, dessen Leben im Zeichen der Völkerverständigung stand, wird mit einer bronzenen Statue am Ufer der Oder und einem Plakat auf der Europabrücke geehrt.
Im Jahre 1940 wurde er bei einer Massenrazzia von SS-Truppen aufgegriffen und in das Vernichtungslager Auschwitz gebracht. Dort war er 6 Monate lang von 1940- 1941 gefangen: „Wenn mir jemand, vor 60 Jahren, als ich geduckt auf dem Appellplatz des KZ Auschwitz stand, gesagt hätte, dass ich Deutsche, Bürger eines demokratischen und befreundeten Landes als Freunde haben werde, hätte ich ihn für einen Narren gehalten.“
Der Sohn einer katholischen Beamtenfamilie, der am Rande eines jüdischen Viertels von Warschau aufwuchs, verbitterte trotz der Grausamkeiten, die er in Auschwitz erfahren musste, nicht. „Ich wurde also nach Auschwitz gebracht, wo ich die Häftlingsnummer 4427 gehabt habe. Nicht nur, dass ich selbst verprügelt wurde, aber dass die anderen Leute, ehrwürdige Leute, Priester, Lehrer, verprügelt und erniedrigt oder getötet wurden in meiner Anwesenheit, das war für mich eine ganz neue Problematik. Meine Welt befand sich in Auflösung, das war ein Erdbeben in meinem damaligen Leben.“
Nach dem Krieg stand Bartoszewski in Opposition zum kommunistischen Polen. Während er als Journalist arbeitete, geriet er ins Visier der polnischen Staatssicherheit und wurde 6 Jahre lang inhaftiert. 1955 wurde er rehabilitiert und konnte als Publizist und Historiker arbeiten.
Als in den 1980er Jahren aus der Streikbewegung, die Gewerkschaft Solidarność entstand, engagierte sich Bartoszewski für diese Bewegung, was ihm nach Verhängung des Kriegsrechts eine erneute Haftstrafe einbrachte. Nach der Wende dann wurde er polnischer Botschafter in Wien. Ab 1995 übernahm er das Amt des Außenministers.

Foto: Sabine Küster-Reeck
Eine Welt der Wunder
Umgeben also von berührender Natur, die auf beiden Seiten noch sich selbst überlassen ist; unter einem weiten und immer wieder unglaublichen Himmel, der so wechselhaft ist, wie die Farben der Ostsee; kommen Geschichte und Natur irgendwie zusammen.
Wir erfahren als Besucher beim Spaziergang, oder mit dem Rad beim Innehalten etwas Besonderes: Es sind Wunder, die uns umgeben. Vor Jahrzehnten wurde hier, an dieser Stelle, zum Ende des 2. Weltkrieges, bis aufs Messer gekämpft, kamen unzählige Menschen beider Seiten um ihr Leben. Gewalt und Zerstörung wütete in unschuldiger Natur. Hass und Unverständnis beherrschten lange das Bild des jeweils anderen.
Und nun pure Naturschönheit, wildes Wasser, Tiere, Pflanzen und Erholung suchende Menschen aus beiden, einst so verfeindeten Ländern. Der Besucher steht berührt vor dem bronzenen Andenken an einen Mann, dem nie die Würde abhanden kam und der sich zeitlebens für Gerechtigkeit und Völkerverständigung engagierte.
„Ich glaube, dass die polnisch-deutschen Beziehungen zur Welt der Wunder gehören. Die deutsch-polnischen Beziehungen haben so große Fortschritte gemacht, wie keine anderen in Europa.“ Władysław Bartoszewski starb am 24. April 2015 in Warschau. Noch wenige Stunden vor seinem Tode hatte er an einer Rede zur polnisch-deutschen Verständigung gearbeitet.
Auch er hätte an der Europabrücke ganz gewiss seine Freude gehabt, denn sie bildet eine „Bridge over troubled water.“ („Like a bridge over troubled water, I will ease your mind…….“ von Paul Simon, Art Garfunkel)

Foto: Sabine Küster-Reeck

Foto: Sabine Küster-Reeck
Über die Autorin:
Sabine Küster-Reeck ist gelernte Schauwerbegestalterin. Sie absolvierte beim Deutschen Journalistenkolleg in Berlin ein 2-jähriges Fernstudium im Bereich Journalismus und entdeckte besonders den Reisebericht für sich. Fünf Jahre lang lebte sie mit ihrem Mann im Norden Äthiopiens und unternahm zahlreiche Reisen in Afrika. Gegenwärtig gilt ihr besonderes Interesse den osteuropäischen Ländern. Sie lebt heute in Berlin und Brandenburg.
Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.



![[Live ab 9 Uhr] Pressegespräch der AFD zur Klage gegen GG-Änderung durch alten Bundestag](https://images-de.epochtimes.de/uploads/2025/03/Thumbnail-AfD-Klage-GG-Aenderung-400x225.jpg)





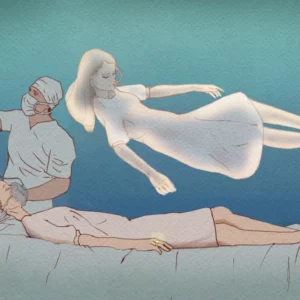









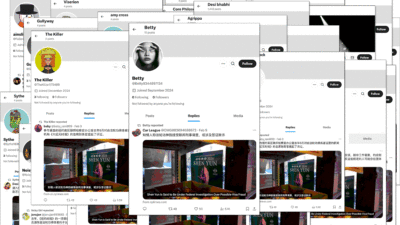







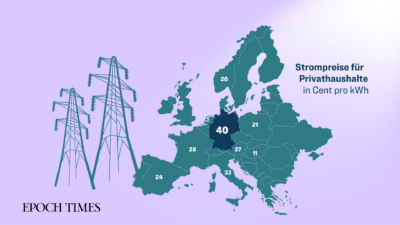
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion