
Warum spielt ein Kind?

Spielen ist für die Entwicklung von Kindern von herausragender Bedeutung. Es fördert erwiesenermaßen das Nervenwachstum; aus Sicht der Hirnforschung den Aufbau und die Plastizität der Verbindung unterschiedlicher Hirnregionen und aus Sicht der Stressforschung lässt sich anhand der Ausschüttung des Stresshormons Cortisol in den meisten Fällen eine Stressreduzierung feststellen und gleichzeitig eine vermehrte Ausschüttung des beziehungsfördernden Hormons Oxytocin.
Fragt man ein Kind – etwa bis zu seinem sechsten, siebten Lebensjahr – „Warum spielst du?“, sehen die meisten Kinder den erwachsenen Fragesteller mit großen Augen an, so als käme er geradewegs vom Mond. „Ich spiele natürlich, weil ich spielen will“ oder „Ich spiele, weil mir spielen Spaß macht.“
Manches ältere Kind, jetzt bereits ein Jugendlicher, wird vielleicht abwertend sagen: „Spielen ist nur etwas für kleine Kinder“. Oder: „Wenn ich ein Computerspiel spiele, dann, weil es mich aus der Wirklichkeit entführt und ich endlich einmal die oder der sein kann, die oder der ich gerne sein würde.“ Dabei spielen dann häufig Machtfantasien, Dominanzstreben oder die Identifikation mit jemandem, der man sein will, aber in „echt“ nicht sein kann, eine bedeutende Rolle.
Bindungen und die soziale Funktion des Spiels
In gewisser Hinsicht spielen Kinder von Geburt an, denn ihr Spiel öffnet ihnen den Zugang zur Welt und zu ihren nächsten Bezugspersonen. Wir können diese Form des Spiels auch als Anfänge eines „dialogischen Spiels“ bezeichnen. Es schafft gewissermaßen die Voraussetzungen zu allen weiteren Spielarten.
Alles beginnt schon kurz nach der Geburt mit dem Blick und der versteckten Frage des Kindes, ob sein Blick, wie es hofft, von denen, die es ansieht, auch erwidert wird. Denn so entsteht Resonanz.
Das Kind drückt mit seinem Blick also das, wie ich es nenne, existenzielle Bedürfnis aus, gesehen zu werden.
Dasselbe geschieht im sogenannten „Lächeldialog“ und später, mit etwa 18 Monaten, mit den ersten Worten, die das Kind an seine ihm nächsten Bezugspersonen richtet und hofft, eine freundlich zugewandte Antwort zu bekommen. Auch die Zeigefunktion, wie wir sie bei allen Kindern im Alltag beobachten können, spielt eine wichtige Rolle. Das Kind zeigt auf etwas und will uns damit sagen: „Schau her, das interessiert mich, das ist mir gerade wichtig.“ Auch in diesem Fall freut es sich, wenn wir uns mit ihm über den gezeigten Gegenstand oder die gezeigte Szene verbinden, indem wir seinem Hinweis folgen und ihm antworten.
Warum also spielt das Kind? Es spielt, um mit spielerischen Mitteln sich selbst und die Welt, die es umgibt, zu erreichen und zu erkunden. Dabei sucht es für sich auch nach persönlicher Anerkennung. Nicht dafür, etwas geleistet zu haben, sondern für sich als einzigartiger kleiner Mensch: „So, wie ich bin, bin ich gut. So wie ich bin, werde ich angenommen.“
Wenn Gesten und Worte ins Leere greifen
Bleibt nun eine entsprechende Reaktion auf die anfängliche Spielidee des Kindes aus, nämlich spielerisch Kontakt zum anderen aufzunehmen, um von ihm eine Antwort zu bekommen, greifen Gesten und Worte buchstäblich ins Leere. Dann bleibt ein Gefühl von Verlassensein, das Gefühl, nicht gesehen, nicht gehört zu werden, beim Kind zurück.
Nahezu alle psychischen Auffälligkeiten eines Kindes finden hier ihren Ausgangspunkt. Dann wird das Spiel abgelöst von stereotypen Bewegungen, im schlimmsten Fall stößt das traumatisierte Kind seinen Kopf immer wieder an die Wand, um sich wenigstens auf diese Weise zu spüren. Oder es läuft später immer Hin und Her, worin sich seine Orientierungslosigkeit ausdrückt, etwa in der Schule, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, an der es ihm als Kleinkind gemangelt hat. Auch das Selbstverletzen von Jugendlichen hat hier ihren Ausgangspunkt. Die innere Leere durch die Empfindung des eigenen Schmerzes vergessen und auszublenden. Oder auch unterschiedliche Suchterfahrungen.
Das Kind braucht den spielerischen Dialog mit denen, die ihm am wichtigsten sind. Ein schönes Beispiel ist übrigens das Fangen oder das Versteckspiel, das Kinder über alle Kontinente so lieben. Da wir alle einmal Kinder waren, wissen wir auch selbst um seinen Reiz. Worin liegt dieser? Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, bringt ihn hervor: Er liegt nämlich im Gefundenwerden! Natürlich freut man sich, nicht als Erster oder als Zweiter entdeckt zu werden. Aber wenn alle Kinder gefunden wurden und nur noch eines übrig bleibt, dann fangen die meisten Kinder von sich aus an, leise Geräusche zu machen. Denn eigentlich wollen sie gefunden werden.
Nichts kann schlimmer sein, als nicht gefunden zu werden, das Gefühl, vergessen worden zu sein, wenn die anderen Kinder ihr Spiel fortsetzen. Denn dann bleibt man für die anderen ja unsichtbar, wird buchstäblich „übersehen“.
Also meldet sich das Kind entsprechend. Mit dem Fangen ist es genauso. Immer nur wegzulaufen und nie gefangen zu werden, mag für das ältere Schulkind ein Zeichen sein, schneller zu sein als die anderen, womit wir aber schon beim Leistungsgedanken sind, der vor allem ab dem Schulalter häufig die ursprüngliche Spielidee begleitet.
Aber das kleine Kind, das nie gefangen wird, hat in diesem Fall ebenfalls die Sorge, nicht erreicht und entsprechend nicht beachtet zu werden. Auch hier liegt der Reiz des Spieles in der sozialen Begegnung mit anderen.
Der Diplom-Psychologe Dr. phil. Claus Koch ist Mitbegründer des Pädagogischen Instituts Berlin, Autor und Publizist.









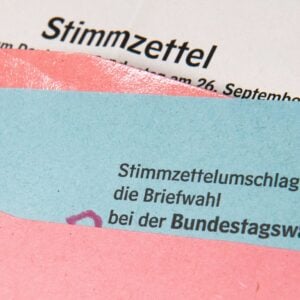


















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion