
Über Euphorie, Leiden und die Sehnsucht nach einem Ende des Krieges

Für viele Menschen in Europa ist der Krieg etwas, das sie nur aus den Geschichtsbüchern, Filmen und vielleicht noch aus Erzählungen kennen. Wenn heute über die Aktivierung der Wehrpflicht und einen militärischen Einsatz in anderen Ländern diskutiert wird, dann, so scheint es, bleiben die Schrecken des Krieges gern unerwähnt.
Wer dennoch eine Ahnung davon bekommen möchte, welche Stimmungen und auch Leiden der Krieg hervorbringt, dem sei die Lyrik der Soldaten empfohlen, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben. An einem Mangel an Material kann diese Beschäftigung jedenfalls nicht scheitern.
Geert Buelens schreibt in seinem Buch „Europas Dichter und der Erste Weltkrieg“, dass „in Deutschland im ersten Kriegsmonat an die fünfzigtausend Kriegsgedichte pro Tag verfasst“ wurden.
Euphorie und Schrecken
In ihnen zeigt sich die ganze Bandbreite an Emotionen. Von der Euphorie zu Beginn des Ersten Weltkrieges bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich der Sturm der Begeisterung löst und die ungeschönte Realität des Schlachtfeldes zum Vorschein kommt. Für eine erste Übersicht eignet sich die Schrift „Die Dichter und der Krieg – Deutsche Lyrik 1914 – 1918“ aus dem Hause Reclam.
In ihr werden Gedichte von bekannten und weniger bekannten Dichtern aus jedem Kriegsjahr wiedergegeben. Von „Ihr satten Toten! Steht auf und wacht! / Der Sturmtag dämmert! Es ist Schlacht!“ aus dem März 1914 bis zu „Die Flüsse bluten. Erde bricht wehschreiend auf. / Die Häuser wanken in den Fundamenten. / Blau recken Frauen Arme steil hinauf. / Zerballt. Zerrissen. Höhnend Sakramenten.“ aus dem Jahre 1917.
Das erste Zitat zeigt die letzten beiden Zeilen des Gedichts „Der Söhne junger Ruf“ von Oskar Kanehl. Die anderen Zeilen machen die komplette erste Strophe des zweistrophigen Gedichts „Ende“ von Herbert Kühn aus. Im Gegensatz zu vielen Kollegen haben diese beiden Dichter den Ersten Weltkrieg überlebt. Kanehl arbeitete und lebte bis zu seinem Tod 1929 in Berlin. Kühn wurde Professor und starb 1980 in Mainz.
Dichter gegen Dichter
Doch nicht alle haben die Euphorie geteilt, nicht alle Dichter haben wie Richard Dehmel 1914 in seinem „Lied an alle“ Zeilen wie „Mensch, dein Glück heißt Opfermut – / Dann kommt der Sieg, / Der herrliche Sieg!“ geschrieben. Oder wie Rudolf Leonhard in „Soldaten“ die kriegerische Auseinandersetzung bevorzugt: „Aber für uns ist es besser, Krieg zu haben als Frieden.“
Der Expressionist Alfred Lichtenstein befand sich bereits vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges als Freiwilliger im bayerischen Infanterieregiment, doch er schätzte die möglichen Auswirkungen des Krieges schon deutlich realistischer ein als manche Kollegen.
In seinem Gedicht „Abschied“ schrieb er zu Beginn des Krieges: „Vielleicht bin ich in dreizehn Tagen tot.“ Letztlich stand ihm mehr Lebenszeit zur Verfügung, aber er sollte Recht behalten. Am 25. September 1914 starb er an der Westfront in Frankreich.
Lyrik und Zensur
Die Dichter mussten aber auch aufpassen, dass sie nicht zu kritisch wurden. Denn die Zensur ließ ihre Gedichte nicht unbeachtet. Geert Buelens schreibt in seinem Buch „Europas Dichter und der Erste Weltkrieg“: „Jede Veröffentlichung, die auch nur entfernt mit dem Krieg oder der Armee zu tun hatte und – sehr ausdrücklich – Texte, die den Burgfrieden zu stören drohten, […] mussten zur Kontrolle vorgelegt werden. Allein in Berlin arbeiteten während des Krieges mehr als zweihundertfünfzig Beamte ganztags in der Zensurbehörde, um diese Verordnungen zu kontrollieren.“
Wer sich nicht wie Alfred Kerr, der ab 1912 der Herausgeber der Zeitschrift „Pan“ war, angepasst hat, konnte im schlimmsten Fall eben nichts mehr veröffentlichen. Erich Mühsam war der Herausgeber der Zeitschrift „Kain“, der bereits erwähnte Oskar Kanehl gab den „Wiecker Boten“ heraus. Beide Zeitschriften „stellten mit dem Juli-Heft ihr Erscheinen ein“.
Nur Mühsams „Kain“ erschien nach dem Ersten Weltkrieg wieder. Außerdem wird sich Mühsam Ende 1918 mit Ernst Toller und Gustav Landauer an die „Spitze der Rätebewegung“ in München setzen. Nachzulesen in „Träumer – Als die Dichter die Macht übernahmen“ von Volker Weidemann.
Über Todeswünsche und Menschenfreunde
Nachdem sich die Euphorie nicht lange halten konnte – „Die Kriegsbegeisterung mancher junger Künstler hatte oft nur wenige Monate, manchmal wenige Tage gedauert“ –, wurden die Grausamkeiten des Krieges in den Gedichten mitunter sehr detailgetreu wiedergegeben.
Trotzdem tauchten immer wieder Zeilen auf, die nicht nur das Negative im Blick hatten, sondern (wieder) einen Wert im Menschen sahen. Natürlich gab es weiterhin Dichter, die wie Wilhelm Klemm in „Abend im Feld“ bereits 1914 aufgrund ihrer Kriegserfahrungen offenbar keinen Ausweg mehr sahen, als zu fragen: „O du suchende Kugel, wann kommst du zu mir?“
Klemm überlebte den Krieg, er starb 1968, doch mit lebensbejahenden Worten kann sein Gedicht offenbar nicht punkten.
Dagegen schrieb der Dichter Karl Otten 1917 in dem Gedicht „Für Martinet“ zum Beispiel folgende Zeilen: „Nieder mit der Technik, nieder mit der Maschine! / Wir wollen nichts mehr wissen von euren verdammten höllischen Erfindungen.“
„Du schüttelst mir die Hand, ich erkenne Dich! / Ich habe allen von Dir erzählt, daß du lebst und daß es keine / Feindschaft mehr gibt.“; „Gift, Gift! Lüge, Dreck! Es gibt keinen Feind! / Nur Menschen!“
Barbaropa
In dem Gedicht „Frage“ von Albert Ehrenstein wird ebenfalls „die Möglichkeit einer Erneuerung angedeutet“: „O ihr vertempelten Kirchen, / Fern des Himmels ungeborenem Ostrot / Der Menschwerdung des Menschen, / Wann blüht es blau / Über Blutwolken dahin?“
Schon in der Verwendung des Begriffes „Barbaropa“ in seinem Gedicht „Stimmen über Barbaropa“ zeigt sich Ehrensteins ablehnende Haltung gegenüber dem Kriegsgeschehen.
In der Sekundärliteratur, in „Der Krieg in der Lyrik des Expressionismus“, heißt es unter anderem, dass die kritische Betrachtung des Kriegsgeschehens die Folge der eigenen „Betroffenheit“ war und in erster Linie weniger mit „politischen Einsichten und revolutionärem Engagement“ zu tun hatte.
Edlef Köppen will in „Loretto“ träumen. „Einen Tag lang in Stille untergehen! / Einen Tag lang den Kopf in Blumen kühlen / Und die Hände fallen lassen / Und träumen: diesen schwarzsamtnen, singenden Traum: / Einen Tag lang nicht töten.“ Es ist nur ein Traum, doch es ist etwas anderes, als euphorisch in den Krieg zu ziehen. Den Menschen als Individuum und nicht als Ziel zu betrachten, beschäftigt Köppen.
Genug ist genug
Paul Zech wird in den letzten Zeilen von „Genug … Genug!“ noch deutlicher: „In uns gesät, anschwillt zum Wind, / Anschwillt zur Flut, zur höchsten Glut; / Wind, Flut und Glut –: ja diese drei / Durch dein, durch unser aller Blut / Aufbrüllen als ein Schrei –: / Genug! Genug! Genug!“
Es sind nicht nur die Soldaten, die sich, je länger der Krieg dauert, mal mehr, mal weniger deutlich gegen ihn stellen und den Wert des Menschen in ihren Gedichten hervorheben. Die deutsche Dichterin Else Lasker-Schüler schreibt in „Georg Trakl“ über den gleichnamigen Dichter: „Georg Trakl erlag im Krieg von eigener Hand gefällt. / So einsam war es in der Welt. Ich hatt ihn lieb.“
Trakl war Soldat, doch der Tod eines Menschen steht immer auch für einen Verlust, den die Umstehenden erleiden müssen. Daran erinnert der letzte Satz von Lasker-Schülers Gedicht. Und daran erinnert auch der Dichter Gerrit Engelke.
In seinem letzten großen Gedicht „An die Soldaten des großen Krieges“ adressiert er all die anderen Kämpfer. Sie sollen ihre Waffen wegschmeißen und den Krieg beenden. Die folgenden Zeilen stellen nur einen Ausschnitt dar, fokussieren aber deutlich das mitmenschliche Verhalten unter den Menschen: „Franzose du, von Brest, Bordeaux, Garonne, / Ukrainer du, Kosak vom Ural, Dnjestr und Don, / Österreicher, Bulgare, Osmanen und Serben, / Ihr alle im rasenden Strudel von Tat und von Sterben – / Du Brite aus London, York, Manchester, / Soldat, Kamerad, in Wahrheit Mitmensch und Bester –.“
Über den Autor:
Ronny Ebel ist Literaturwissenschaftler und im Begriff, sein Philosophiestudium an der Humboldt-Universität zu Berlin abzuschließen. Er beschäftigt sich mit menschlichem Verhalten und den Auswirkungen ihres Tuns. Seinen Fokus legt er auf Verantwortung und demokratische Partizipation.























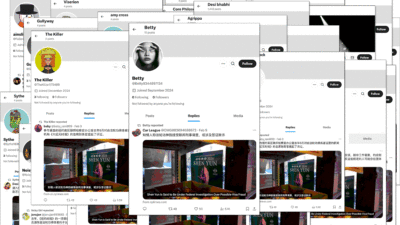








vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion