
Philipp Stölzls neuer Parsifal in der Deutschen Oper Berlin

Philipp Stölzls ‚Bibelfilm‘ über Parsifal mit Matti Salminen und Klaus Florian Vogt in den Hauptrollen an der Deutschen Oper Berlin.
„Zur Kreuzigung vorne links und bitte jeder nur ein Kreuz!” Man setze in das berühmte Zitat der Monty Pythons einfach statt „Kreuzigung“ das Wort “Gralsenthüllung” und befindet sich direkt in der surreal mittelalterlichen Welt von Philipp Stölzls neuem Berliner Parsifal.
An der Deutschen Oper wurde Richard Wagners Bühnenweihfestspiel gestern zum klischeetriefenden Bibelfilm in Zeitlupe, der das Publikum weitgehend unbegeistert bis unberührt hinterließ. „Ja, hätte er doch wenigstens versucht eine Geschichte zu erzählen“, klang in einigen Foyergesprächen an. Es hätte ein großer Abend werden können in der Deutschen Oper Berlin. Hätte. So blieb es wieder bei einer rein musikalischen Traumaufführung, dank Donald Runnicles am Pult, Klaus Florian Vogt als Parsifal und Matti Salminen als Gurnemanz.
Graue Betonwände umgeben die Szene, die aus einer naturalistischen Felsformation und einer drolligen Burg besteht. Kein Stückchen Himmel ist zu sehen und es gibt keinerlei Hinweise auf die Welt da draußen. Bei Stölzl scheint die Welt der Gralsritter und des Glaubens ein in sich erstarrter Kosmos zu sein, in dem zwar die Zeit vergeht – der Anfang spielt im Mittelalter, das Ende in der Neuzeit – aber Entwicklung hat nicht stattgefunden. Sind es Ritual gewordene Hirngespinste, die diese Leute umtreiben?
Der Gral wird in roboterartigen Posen aus dem Schrein gehoben, nicht von Amfortas oder Parsifal, sondern von einem Sonderkommando aus Statisten. Aber die geheiligte Schale erglüht nicht, nein, es passiert überhaupt nichts Wundersames. Warum dann die Ekstase und die Ohnmachtsanfälle derer, die nach ihrem Anblick schmachteten? Etwas ratlos und leer fühlt sich der Zuschauer hinterher.
Stölzl liefert uns über weite Strecken die Karikatur einer Parsifal-Aufführung. „Die tun nur so friedlich. Die sind eigentlich hochaggressiv und gewaltbereit…“ ist die Botschaft, die sich aufdrängt, wenn die Gralsritter sich selbst geißelnd und Kreuze schleppend hereinziehen, um nach vollbrachter Zeremonie gestärkt und Schwerter schwingend von dannen zu toben. Von wegen Frieden und heiliger Wald. Der Männerchor spielte, wie ihm geheißen und sang trotzdem erstklassig, innig, majestätisch und überwältigend schön. Ein würdiges Pendant schafften die Damen im zweiten Akt, die zu den Stimmen der Solistinnen einen verführerischen Blumenmädchen-Chor boten, so silbrig und makellos wie man ihn selten hört.
In der trostlosen Felsenlandschaft des Bühnenbildes ist jedes Detail naturalistisch ausgearbeitet. (Bühne: Conrad Moritz Reinhardt und Philipp Stölzl) und doch bleiben die Bilder, die einst der größte Mythos des Abendlandes waren, sinnentleerte Schablonen.
Gerade wenn man innerlich begonnen hat, die statuarisch gespielte Kreuzigung Jesu passend zu Wagners Vorspiel zu finden, beginnen deren verhüllte Gestalten wie auf Knopfdruck zu weinen. Sodann angeln sie mit gierigen Händen nach dem Speer, der später im Stück eine entscheidende Rolle spielt. Diese Bilder wirken deshalb so lächerlich und abgedroschen, weil sie „die Gläubigen“ immer als anonymisierte Masse agieren lassen und in jedem Moment eine unverkennbare, moderne Arroganz zur Schau tragen: Diese pauschale Ansicht, dass die Leute der biblischen Zeit alle wallende Gewänder in Braun und Beige trugen und intellektuell ziemlich einfach gestrickt waren …
Dazwischen gab es Bruchstücke von wunderbarem Theater. Wenn zum Beispiel plötzlich wie in der Artus-Sage ein Schwert im Fels steckt, für Parsifal. Er geht also nicht als dummer Junge aus der Zeremonie heraus, er hat etwas mitbekommen. Oder wenn die Verführerin Kundry, bevor sie ihn küsst, ihn wörtlich einzuwickeln versucht – in ein schwarzes Tuch.
Die Lichtregie war ein besonderes Ärgernis (Ulrich Niepel), weil derart trüb und dunkel, dass man die Darsteller erst beim Schlussapplaus richtig sehen konnte. Und das war schade, waren darunter doch einige Persönlichkeiten, die Idealbesetzungen, ja sogar singuläre Erscheinungen waren.
Aus musikalischen Gründen sehr zu empfehlen
Bitte weiterlesen auf Seite 2
[–]
Allen voran der große finnische Bass Matti Salminen als Gurnemanz, der seine Rolle nicht spielen musste, weil er selbst der würdevolle, väterliche Riese ist. Er erzählte seinen Part über weite Strecken im Sprechgesang, auf eine Weise, die enorm eindringlich war: Was seiner gealterten Stimme an Geschmeidigkeit fehlte, das machte er durch Tiefgang und Lebenserfahrung wett. Ein Urgestein, das man erlebt haben muss.
Klaus Florian Vogt war Bilderbuch-Parsifal und Charakterdarsteller in einem. Er hat durch seine eigentlich unwagnerianische Stimmfarbe genau die knabenhafte Unschuld und Naivität, die der „reine Tor“ braucht, um als solcher zu überzeugen. Und man merkte ihm an, dass er völlig in seiner Rolle aufging. Kindlich zerbrechliche Momente gingen bei ihm nahtlos in den plötzlichen Ausbruch der Willensstärke und Erkenntnis über. Ein Glücksfall, besonders in der Szene mit Kundry.
Fantastisch und ebenbürtig war auch seine Kundry, flirrend, sinnlich schön und textverständlich gesungen von Evelyn Herlitzius. Sie hatte eine dunkle Tiefe, starke Höhen und eine Menge Zwischentöne. Mit ihrer großartigen schauspielerischen Präsenz machte sie auch im etwas grenzwertigen Wanderhuren-Outfit eine perfekte Figur (Kostüme: Kathi Maurer). In dieser Rolle, die zum hysterischen Überzeichnen einlädt, blieb sie wunderbar ernsthaft. Das Publikum war von ihr völlig hingerissen.
Der vierte Star des Abends war Thomas Johannes Mayer als Amfortas. Kraftstrotzend und gebrochen gleichermaßen, diese Mischung lag ihm und seinem intensiven, sandig timbrierten Bariton. Er legte sich mit Leidenschaft in die Rolle des leidenden Gralskönigs. Ein weiterer sänger-darstellerischer Volltreffer.
Mit schneidender Stimme trat Klingsor Thomas Jesatko auf, ein böser Wichtigtuer, dessen Erscheinungsbild einem fiktiven Azteken-Priester glich. Er opfert mit seinen Blumenmädchen einen Menschen und reißt ihm das Herz aus der Brust. Albert Pesendorfer hatte als Titurel einen kurzen aber starken Einsatz.
Glanzleistung von Runnicles und dem Orchester der Deutschen Oper Berlin
Donald Runnicles am Pult war einmal mehr der heimliche König des Abends.
Sein Parsifal hatte ein sehr durchdachte Gesamtanlage und einen wunderbaren Nuancenreichtum und klang niemals erdrückend schwer oder schwülstig-wehmütig. Nein, die Musik hatte die Natürlichkeit eines allgegenwärtigen Sphärenklangs. Dass der GMD sparsamer als sonst mit Höhepunkten umging und sich oberflächlich gar nicht um Effekte zu kümmern schien, wurde der Schlüssel zu einer wirklich herausragenden Aufführung. Sein brillant musizierendes Orchester schuf mehr als einmal Atmosphäre durch totale Zurückhaltung. Besonders gut gelang dies am Beginn des dritten Aktes, der wie ein Eintauchen in die Zeitlosigkeit klang. Runnicles und sein Orchester schafften es, Schweigen und Stille zu Musik zu verwandeln und das war faszinierend.
Am Ende ernteten sie, wie alle Hauptdarsteller und der Chor, orkanartigen Beifall.
Nur das Regieteam kam nicht so gut weg, mit dem Applaus einer Teilmenge und sehr vielen entschlossenen Buhs.



















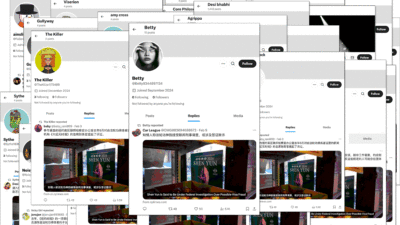







vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion