
Pianist Robert Neumann: „Keiner von uns braucht es, eine Kopie zu sein“

Ein großer, ovaler Esstisch für sechs Personen ist ihm in seiner Wohnung genauso wichtig wie sein Instrument zum Üben. Pianist Robert Neumann, 23 Jahre jung, ist bereits vielfach ausgezeichnet und prämiert. Drei Jahre lang förderte ihn der SWR2 als „New Talent“, sein CD-Debüt erhielt den OPUS KLASSIK-Preis in der Kategorie „Nachwuchskünstler“. Jüngst im Oktober gewann er Gold beim NTD International Piano Competition 2024 in New York.
Er gilt als Ausnahmetalent, ist Kind eines moldauischen Cellisten und einer griechischstämmigen Mutter, ebenfalls Pianistin. Drei Muttersprachen bekam er so in seinen Lebensrucksack: russisch, griechisch und deutsch.
Er wuchs in Stuttgart auf und erhielt dort an der Musikschule mit vier Jahren seinen ersten Klavierunterricht. Mit elf wurde er Jungstudent an der Musikhochschule Freiburg.
Für Ton- und Bildaufnahmen treffen wir uns im Krönungskutschensaal der Musikhochschule Hanns Eisler in Berlin. Anschließend sitzen wir uns an diesem kurzen, aber sonnigen Novembernachmittag in seiner Wohnung gegenüber. Seine herzliche und offene Art lässt mit Leichtigkeit ins Gespräch kommen.

Robert Neumann. Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times
Robert, ich freue mich, hier bei dir zu Hause mit dir reden zu können.
Dito, ist mir ein Fest.
War es schon immer klar für dich, dass du Pianist wirst?
Es gibt das Vorurteil, dass Musiker, bevor sie sprechen oder laufen können, ans Instrument gesetzt oder geprügelt werden – natürlich umso eher, wenn man in einer Musikerfamilie groß geworden ist.
Ich glaube, es sind viele Faktoren, die dazu führen, ein Pianist zu werden. Man geht einen Weg, der auf der einen Seite von Chancen bestimmt ist, aber auch von Bequemlichkeit oder guten Gelegenheiten. Ich hatte von beidem sehr viel. So war es der einfachere, der natürlichere Weg.
Hattest du gute Mentoren, Lehrer, Menschen, die dich auf diesem Weg begleitet haben?
Auf jeden Fall. Meine Eltern haben zum Beispiel entschieden, mich nie selbst zu unterrichten, sondern haben mich noch vor meiner Schulzeit in die Musikschule gebracht, damals in Stuttgart.
Jeder Institution war ich auch lange verbunden. Bei meiner ersten Lehrerin, Monika Giurgiuman, war ich rund zehn Jahre.
Du hast mit vier Jahren begonnen …
Ganz genau. Ab meinem elften Lebensjahr – eine kurze Zeit auch parallel – bei Elza Kolodin an der Hochschule in Freiburg, mit der ich auch gut neun Jahre verbracht habe, bis ich nach abgeschlossenem Grundstudium nach Berlin gezogen bin und seitdem mit meinem Professor Eldar Nebolsin arbeite.
Was sind die Themen, die Dich gerade umtreiben?
Das, was mich umtreibt, ist immer das aktuelle Projekt. Sei es das, was morgen oder übermorgen ansteht, oder sei es erst in einer oder zwei Wochen. Die Balance zwischen der aufgewendeten Zeit, die man eben für alle verschiedenen Dinge übrig hat, ist immer durch den Kalender bestimmt.
Das ist, glaube ich, unvermeidlich, wenn man gewissenhaft arbeiten und seine Qualität auf die Dauer wahren möchte.
Ich habe in den vergangenen Jahren versucht, eine gute Balance zu halten zwischen Soloabenden, Kammermusik und Projekten mit Orchester. Das sind wunderbare Chancen, diesen erweiterten, riesigen Klangkörper für sich nutzen zu können und in gute, fruchtbare Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Dirigenten oder der entsprechenden Dirigentin zu kommen.
In den letzten ein oder zwei Jahren schreibe ich wieder deutlich mehr Musik, die immer regelmäßiger nicht nur von mir, sondern mit anderen oder von anderen auf die Bühne gebracht wird. Dahingehend verschiebt sich mein Zeitaufwand.
Gibt es eine Botschaft in deiner Musik?
Es wäre zu einfach, wenn ich sage würde, dass es in meiner Musik um A, B und C geht, denn dann ginge der Charme jedes neuen Werkes verloren. Es ist auch jedes Mal ein Neuentdecken der Sicht auf die Dinge, immer abhängig von der Form, von der Besetzung, einfach nur von der kleinsten Zelle, aus der das Ganze entspringt.
Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass die Musik zwar konstruiert und gut gebaut ist und handwerklich alle Qualitäten zeigt, aber sowohl den Spieler als auch den Zuhörer berührt, also anders als bloß intellektuell erreicht.
Es kann sein, dass ich mit meiner Musik, wenn nicht 100, so doch 80 Jahre zu spät komme. Ich bin beileibe kein Avantgardist. Ich würde sagen, dass 90 Prozent meiner Musik, auch wenn sie nicht tonal ist, so doch tonal in althergebrachten Formen gedacht ist.
Wir müssen unsere Wege finden, die Formen, die zum Kanon gehören, anzupassen – diese zu sprengen, klingt immer so radikal, so rebellisch –, damit ein neues Kunstwerk reizvoll bleibt, wenn es auf die Bühne kommt.
Letzten Endes haben doch alle althergebrachten Formen immer gemein, dass sie mit bestimmten psychologischen Erwartungsmustern spielen und diese entweder erfüllen oder nicht erfüllen. Ich denke, dass man sich dieser Elemente bedienen muss, um eine gute Dramaturgie, einen spannenden Ablauf zu erzeugen und ihn dann in den nächsten Schritten anzureichern mit gutem wie schönem Material.
Gibt es im Tonalen genug „Futter“, um Neues zu schaffen?
Auf jeden Fall. Es ist doch wie in der Prosa und der Lyrik. Wir werfen auch nicht alles über den Haufen, was wir kennen. Natürlich, wir passen die Syntax an, wir passen unser Vokabular an und unsere Lyrik ist nicht mehr die, die sie vor 150 Jahren war.
Genauso ist es bei der Kulinarik. Auch die Haute Cuisine bedient sich einmal der Kartoffel und verwendet Salz und Pfeffer.
Das Schöpfertum eigentlich in jeder Facette, die das Leben betrifft, sei es der Konsum, sei es ein sehr eklektizistischer Genuss, ist immer die eigenwillige Kombination von Elementen, die schon da waren. Das macht es interessant.
Wir stehen als Künstler an einem riesigen Büfett. An einem Büfett, an dem wir entlangspazieren können, wie durch die Jahrhunderte. Wir picken uns das heraus, was uns am ehesten anspricht, womit wir am ergiebigsten oder am ausdrucksstärksten oder am einfachsten oder am kompliziertesten je nach Gusto arbeiten können.

Robert Neumann, Pianist. Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times
Das hört sich nach Fülle und Freude vor allem an der Arbeit an.
Das ist es immer wieder! Aber ich will keinem etwas vormachen. Natürlich – und jetzt sprechen beide aus mir, der Interpret und der Komponist – gibt es Anteile der Arbeit, die machen weniger Spaß. Manchmal machen sie sogar keinen Spaß.
Aber ich weiß, dass es notwendigerweise gewisse Dinge zu verrichten gibt, damit wir nachher ein Resultat haben, an dem man sich auf der Bühne erfreuen kann. Das sind quasi die Wehen. Daran hat auch keiner Spaß. Aber wir nehmen das auf uns, Tag für Tag, um eben auf der Bühne zu stehen und etwas teilen zu können – unsere Sichtweise, unsere Lesart.
Viele Gleichaltrige scheuen Diese Wehen oder haben Angst davor. Wie bist du zu der Überzeugung gekommen, dass es doch notwendig ist, da hindurchzugehen?
Die Erfahrung lehrt es einfach. Wenn ich in einer Phase in drei Monaten ein Dutzend Konzerte habe und danach im nächsten Vierteljahr nur noch alle drei oder vier Wochen einen Abend spiele, dann merke ich die [Veränderung meiner] Verfassung sowohl physisch als auch an meiner Konzentration, an meinem Arbeitsverhalten, an allem.
Ich merke, dass ich anders konditioniert bin, wenn der Arbeitstakt etwas anderes von mir verlangt. Jetzt zum Beispiel fühle ich mich seit knapp einem Jahr, um es ganz salopp zu sagen, fit. Denn die Repertoirewahl, die Abfolge der Projekte und das, was man zu bearbeiten hat, waren einfach herausfordernd und gleichzeitig sehr bereichernd und befreiend.
Ich finde es unglaublich spannend, die Rollen von Komponist und Interpret im Sinne der klassischen und romantischen Instrumentalkunst wieder einander anzunähern. Ein Beethoven, ein Chopin, sogar ein Rachmaninow waren meisterhafte Schreibende, aber auch meisterhafte Performer und ihres Handwerks mächtig – alles vereint in einer Person.
Ich finde es wert, das zu kultivieren. Und darum bemühe ich mich auch.

Robert Neumann spielt für uns das Präludium h-moll von J. S. Bach in einer Bearbeitung von Siloti, ein Cousin Rachmaninows. Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times
Wie gehst du vor, wenn du dir ein bestehendes Stück neu erarbeitest?
Ganz verschieden. Es ist wie bei allen Dingen eine Erfahrungsfrage. Jeder Komponist hat seine eigene Tonsprache, seine eigenen Vorgehensweisen, Figurationen, Muster, Abläufe.
Ich bin ein leidenschaftlicher Blattspieler. Ich führe mir jeden Tag in rauen Mengen Musik zu, die ich nicht kenne oder die kein Mensch kennt. Randrepertoire. Ich bin auch ein großer Freund unbekannter Orchestermusik, unbekannter Opernliteratur.
Wenn man weniger vertraut ist mit der Sprache eines Komponisten, benötigt man mehr Zeit. Es ist wie bei einem Schauspieler, der in einer Fremdsprache rezitiert, oder bei einem Sänger, der in einer Fremdsprache zu singen hat – man tastet sich langsamer an die Phonetik heran, wenn man noch wenig Kontakt zu der Sprache hatte. Man fährt auf Sicht.
Wenn man einen Komponisten, eine Epoche oder einen Nationalstil sehr gut kennt, dann erschließt sich unheimlich viel schon bei der ersten Durchsicht, noch bevor man überhaupt mit dem Lesen oder dem Blattspiel durch ist. Deswegen denke ich, hängt das immer von dem Einzelwerk ab und von jedem lernt man auch auf neue Weise.
Jedes kleine bisschen Musik verändert unterbewusst unser Verständnis von dem gesamten restlichen Kollektiv an Musik, das wir kennen. Es ist wie ein Mikroskop, das auf ganz vielen verschiedenen hintereinander gelagerten Linsen immer einen neuen Schliff erfährt, der eine weitere kleine Facette des Endresultats entweder zutage fördert oder revidiert.
Helfen da auch deine drei Muttersprachen?
Sicherlich. Jede Sprache hat ihre eigene Melodie, ihre eigenen Laute, sogar ihren eigenen Sprachtonus. Meine Stimme beispielsweise hat in verschiedenen Sprachen verschiedene Spannungslevel und im Grunde sogar verschiedene Sprechhöhen. Das ist naturgegeben durch die jeweilige Sprache, glaube ich.
Es hört sich alles sehr geradlinig an. Da war dein Wunsch, Pianist zu werden und es hat sich einfach entwickelt. Gab es nie eine Situation, in der du dich gefragt hast, wofür du das alles machst?
Retrospektiv bin ich glücklich, diesen Mehrwert zu genießen. Ich habe das Glück, morgens aufzustehen oder sagen wir, vormittags aufzustehen und einfach zu wissen: Ich darf mich jetzt mit dieser Kunst einen weiteren Tag auseinandersetzen. Ich darf mir zu Gemüte führen, was es alles gab.
Es ist auch erlaubt, dass ich etwas hinzufüge, und sei das auch gar nicht nötig und brauche das kein Mensch – ich darf das. Das ist ein sehr hehres, befreiendes Gefühl.
Geradlinig – na ja, man sieht nur die Entwicklung von A nach B. Ganz linear ist nichts, denn ein Weg – und in diesem Fall der individuelle Weg als Künstler, den man einschlägt – ist von Versuchen und Einfällen geprägt. Man versucht allerlei Dinge und einige funktionieren und andere nicht. Das ist kein Plus oder Minus, wenn irgendwas funktioniert oder nicht, denn man kann aus beidem etwas machen.
Ich bin ein Kind des Jahrtausends. Ich gehöre nicht mehr zu der Generation meiner Großeltern, in der ein Künstler sagen konnte – lassen wir ihn in seinen Zwanzigern oder Dreißigern sein – „Ab jetzt spiele ich nur noch Soloabende, und damit werde ich mein Leben bestreiten“.
Das gibt es vielleicht in einzelnen Fällen bei adoleszenten Shootingstars. Das finde ich sehr gefährlich. Ich gönne es jedem, der in diesen Genuss kommt. Aber die Fallhöhe ist sehr groß, wenn man sich die Flexibilität nicht bewahrt und keine sichere Entwicklung da draußen hinlegt, Schritt für Schritt.
Du hast ein Festival initiiert. Was hat es damit auf sich?
Richtig. Das ist der Cannstatter Klavierfrühling. Der Name sagt es: ein Klavierfestival in Bad Cannstatt bei Stuttgart. Es hat in diesem Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Im nächsten Jahr wird es eine zweite Edition davon geben. Immer zwischen Ostern und Pfingsten an fünf Sonntagen.
Meine Idee ist, eine Plattform für die jüngere Generation von Pianisten zwischen 20 und Mitte 30 zu erzeugen.
Des Weiteren wollte ich das Ländle – wie man es unten im Schwäbischen, wo ich groß geworden bin, nennt – zumindest für eine kurze Zeit im Jahr zum Mittelpunkt des pianistischen Geschehens in unserem Land machen, da wir in einem relativ großen Umkreis so etwas lange oder nie hatten.
Was steht im Mittelpunkt des Festivals?
Das Herz ist, dass jeder Künstler, der zu uns mit einem klassischen Klavierabend kommt, sein musikalisches Verständnis mit uns teilt und uns durch sein Programm führt.
Ich lade den Pianisten, die Pianistin ein, weil ich genau diese Person mit ihrer künstlerischen Aussage haben möchte. Im Grunde gebe ich jedem Künstler eine Carte blanche bezüglich der Programmgestaltung.
Genau das schätze ich selbst so: An eine Spielstätte zu kommen und zu wissen, dass ich hier eine Zuhörerschaft habe, die für die ganz große klassische Klavierkunst brennt und sich auf der anderen Seite die Neugierde behält, einen Künstler wahrzunehmen und zu erfassen.
Der Charakter des Künstlers fließt ja unmittelbar in sein Spiel oder sein Werk mit ein.
Ja, immer. Es gibt viele Menschen, gerade hierzulande, die das nicht so gern hören, weil manchmal eine sinnbefreite Glorifizierung der Text- oder Werktreue existiert. Ich bin ein sehr demütiger Mensch, was den Umgang mit Werken betrifft.
Dennoch bin ich der Ansicht, dass der Komponist genauso wichtig wie der Interpret ist. Im Umkehrschluss: Der Interpret ist auch genauso wichtig wie der Komponist. Als ausübender Pianist sage ich: Wir brauchen diesen Kanon, die ganze Literatur.
Wir haben zum Glück ein gesegnetes Instrument. Ich habe gute Freunde und Kollegen, die auch wunderbare Instrumente spielen, aber einfach nicht mit einer solchen Menge an Repertoire gesegnet sind wie wir. Das weiß ich zu schätzen und weiß, dass wir diese Werke brauchen, um uns zeigen zu können.
Auf der anderen Seite brauchen die Komponisten uns als Gesamtheit genauso sehr, weil sonst all das Material, das in der Geschichte geschrieben wurde, nur noch auf dem Papier existierte.
Wirkt das Werk auch auf dich zurück auf deinen Charakter?
Jedes Werk wirkt auf jeden Fall auf mich zurück. Aber nicht unbedingt charakterlich, sondern auf mein Verständnis von Musik. Das ist das, was ich mit dem Schliff meinte.
Wir tragen jeder ein eigenes imaginäres Monokel. Und dieses besteht aus der Gesamtheit all der Musik, die wir erfahren haben, die wir selbst aufgeführt haben, die wir erlebt haben, die wir gelesen haben, die wir irgendwo gehört haben, ohne zuordnen zu können, was und wo es war.
All diese Dinge erzeugen die eigene Perspektive und ich denke, das ist nicht die einzige, aber die erste Wirkung, die Musik auf mich als Spieler hat.
Die Ausdruckskraft deines Spiels ist beeindruckend. Ist das kennzeichnend für dich?
Das wäre unbescheiden zu sagen, dass dies kennzeichnend für mich ist, denn das hat wenig mit mir zu tun. Ich glaube, dass es in der Musik immer eine treibende Kraft gibt. Es gibt keine einzige leere Note sozusagen. Und wenn es sie gibt, dann ist sie tot. Dann schlägt sie auch bei mir keine Saite an, dann ist sie ein toter Ton, wie er aus einer Alarmanlage kommt.
In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde sehr viel darüber diskutiert, was eigentlich Musik ist und ob die Intention der Tonerzeugung schon Musik schafft. Wenn ich hier zweimal mit dem Glas klopfe, ist das schon Musik oder ist das nur Krach? Ich möchte mich da nicht auf eine Diskussion einlassen.
Was ich aber glaube: Eine Alarmanlage macht keine Musik, weil einfach die kontextuelle Komponente fehlt. Ich habe keinen künstlerischen Inhalt respektive keine künstlerische Aussage, also ist es keine Musik.
Die Mehrheit der Leser wird mit mir d’accord gehen, dass eine Aussage generiert werden muss. Und diese Aussage kann auch nur reproduzierend sein. Es gibt wunderbare Musiker, die eine unnachahmliche Demut vor den Werken haben und wirklich versuchen, in ihrer Reinheit, dass uns überlieferte Material wiederzugeben, was zum Teil – abhängig vom Material – göttlich sein kann.
Mir wäre es als Herangehensweise eher fremd. Für Studioproduktionen und um ein Werk in mein Konzertprogramm aufzunehmen, brauche ich Folgendes ganz dringend: Die Notwendigkeit, etwas mitzuteilen aufgrund der Tatsache, dass ich etwas darin gefunden habe, was meiner Ansicht nach noch keiner gefunden hat.
Wir sind uns alle einig: Die Beethoven-Sonaten sind fantastisch; jede auf ihre eigene Weise. Aber sie wurden anderthalb Millionen Mal aufgenommen und auch alle zusammen sehr oft. Niemand braucht eine weitere Aufnahme – Gott bewahre von mir! –, nur weil ich die Werke toll finde.
Aber wenn ich meine, in der einen oder anderen eine Facette gefunden zu haben, die ich auf keiner mir bekannten Aufnahme oder in keiner mir bekannten Livedarbietung je gespürt habe, dann ist das für mich eine ganz patente Motivation, das selbst noch mal umzusetzen.

Robert Neumann. Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times
Soll es in Zukunft so wie in den vergangenen Jahren weitergehen – unterwegs zu den Konzerten, am Komponieren in der Nacht?
Ja, das vor allen Dingen. (Lacht) Es ist müßig, sehr konkrete Pläne zu schmieden, was die Zukunft betrifft, insbesondere wenn sie weiter entfernt ist. Denn das Schicksal würfelt mit großer Freude gegen einen. Je weiter ein Ziel entfernt ist, das man sich steckt, desto mehr Ausfahrten gibt es, an denen etwas anders als geplant laufen kann.
Wichtig ist es, flexibel zu bleiben und im Rahmen der Möglichkeiten, die einem gerade gegeben sind, möglichst aus dem Vollen zu schöpfen. Nur dann wird man sich selbst retrospektiv eine gute Bilanz von aufeinanderfolgenden künstlerischen Schritten attestieren können. Dabei ist das momentane Setting des Musikmarkts für ganz viele Musiker meiner Generation wirklich nicht das einfachste.
Verfolgst du ein nahe liegendes Ziel?
Man darf nicht zu viele Hoffnungen in einen Wettbewerb setzen. Man kann an einem Wettbewerb teilnehmen – man soll sogar –, aber man soll sich keine Chancen ausrechnen.
Und vor allen Dingen: Es ist so schwierig, das richtige Mindset zu treffen. Ich gehe zu einem Wettbewerb, um ein paar kurze Konzerte zu spielen. Runde für Runde. Ich weiß, dass es auf jeden Fall Falsch ist, an einem Wettbewerb in der Absicht teilzunehmen, ihn zu gewinnen.
Ich weiß aber genauso, dass das Gegenteil auch falsch ist und zu nichts führt. Es darf keine völlige Gleichgültigkeit gegenüber dem Vorhaben da sein.
Wie muss man sich einen Studienalltag vorstellen?
Wir sind unglaublich privilegiert. Gerade in Deutschland ist so ein künstlerisches Studium – nicht von unserer Seite, aber vonseiten der Institutionen – sehr aufwendig. Wir haben sehr viel Einzelunterricht und Zuwendungen in kleinsten Gruppen – zu dritt, zu viert.
Zugleich wird berücksichtigt, dass der Musiker mit sich selbst beschäftigt ist. Es gibt das Klischee, dass der Instrumentalist ein asozialer Nerd ist, der sich zwölf Stunden in der Übezelle alleine einsperrt.
Ganz so schlimm ist es nicht, aber irgendwas ist dran. Wir sind auf uns allein gestellt, mit vielen Entwicklungen. Wir bekommen Impulse und dann müssen wir daran arbeiten.
Das ist das Gute und das Verlockende. Deshalb gibt es in dieser Ausbildung keine Massenabfertigung, sondern am Ende stehen verschiedene, eigenartige, im besten Sinne Künstlerpersönlichkeiten, eine neben der anderen und keine gleicht der anderen.
Das ist das Schöne.
Das ist der Reiz. Ich meine, es gibt immer noch das gewisse Richtig und Falsch. Aber es ist kein algebraisches Richtig und Falsch. Wenn wir ein Werk umsetzen, lösen wir keine Gleichung. Wir tragen es nur vor. Und wir tragen es mit unserem Tonfall, mit unserer Gewichtung eines Wortes oder einer Silbe vor. Das ist, was wir tun.
Könntest du skizzieren, wie du mit dem Druck, in der Öffentlichkeit zu stehen, umgehst? Viele kennen die Freude oder Befriedigung, schöpferisch tätig zu werden. Aber den Schritt auf die Bühne zu wagen und dort Spitzenniveau zu erreichen, das schaffen wenige.
Es ist eine Frage der Überzeugung. Bin ich überzeugt von dem, was ich elaboriert habe? Ist es präsentabel? Es ist elementar, dass man sich diese Fragen stellt.
Wenn es das nicht ist, dann sollte ich es auch nicht präsentieren. Ganz einfach. Dann fühl dich frei, das Programm zu ändern.
Ich mache mir meine Gedanken, wie ich ein Programm aufbaue, wie ich die Reihenfolge zusammenstelle. Aufgrund all dieser Gedanken, die man sich im Vorfeld macht, hat man immer einen Bezug zu den Werken. Und der Bezug bringt das Interesse mit sich.
Und das Interesse bringt die Arbeit mit sich und die Arbeit bringt die intensive Auseinandersetzung und meistens auch ein Resultat mit sich. Und wenn man das Resultat hat, bringt das die Überzeugung von der eigenen Ansicht mit sich. Die wird sich ändern. Aber die momentane ist immer da. Das ist also nicht das Hindernis der Bühne, das ist eher die Chance der Bühne.
Hattest du je ein Hindernis für die Bühne?
Nicht, dass ich wüsste. Das ganze Bühnensetting, die Konzertsituation, sie gibt uns viel mehr, als sie uns abverlangt. Nach dem Konzert ist man wacher als vor dem Konzert. Man ist vielleicht müde, weil man anderthalb Stunden öffentlich Hochleistungssport betrieben hat, aber man ist wacher, weil die Energiemuster ganz anders in einem arbeiten.
Ich bin regelmäßig noch fünf Minuten vorher etwas missmutig, meine Durchblutung streikt. Aber das ist verschwunden, sobald man auf die Bühne geht, weil man doch gewissermaßen am Ziel ist. Zumindest am Ziel für diesen Abend.
Wir elaborieren das, was wir tun, um es mit den Zuhörern zu teilen, auch wenn wir das auf der Bühne oft nicht so mitbekommen. Ich kenne genügend Menschen, mich eingeschlossen, bei denen sich der Radius der Aufmerksamkeit sehr stark verkleinert.
Ich glaube, dass wir auch von Energieströmen gespeist werden, die von der Aufmerksamkeit der Zuhörer ausgeht. Ich bin gespannter, wenn mehr Menschen im Saal sind oder wenn sie dichter gedrängt im Saal sind.
Video: Robert Neumann spielt „Holy Grace“ beim 7. internationalen NTD Klavierwettbewerb
Was wünscht sich jemand vom Leben, der so talentiert ist wie du?
Das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, ich kann sie nicht zureichend und schon gar nicht in einem Satz beantworten. Ich denke, das ist phasenweise unterschiedlich. Manchmal ist mir wichtig, viel zu tun zu haben, um Material anzusammeln, um aktiv gewesen zu sein, um alles mir Mögliche gemacht zu haben. Manchmal will ich mich fokussieren, möchte lieber etwas freischaufeln.
Meistens ist es so: Man hat entweder gerade etwas zu viel oder etwas zu wenig zu tun. Der Mensch ist ein unzufriedenes Wesen. Irgendetwas passt immer nicht. Ist doch wahr, oder? Seien wir ehrlich. (lacht)
Aber ich habe große Freude an Kaffeespezialitäten, an gutem Essen. Ich bin ein sehr genüsslicher Mensch. Ich habe große Freude an einer guten Lektüre, die ich nicht kannte. Sei das tatsächlich Literatur oder sei es Musik. Ich glaube, ich wünsche mir, dass es mir gelingt, meine Zeit nach Möglichkeit immer sinnvoll anzufüllen.
Der kurze Novembertag neigt sich dem Ende zu.
Mein Tag neigt sich gerade zum Mittag erst.
Hier habe ich noch ein schönes Zitat von dir: „Ich möchte niemanden kopieren. Ich möchte keine unausgereifte Kopie irgendjemandes sein.“
Das habe ich gesagt?
Ja.
Das ist gut. Halleluja. (Großes Lachen) Man ist nicht frei von Einflüssen, aber ich denke wirklich, die Kopie ist eine sehr gefährliche Masche. Manchmal ist eine Manier zu kopieren ein sehr einfacher Weg, in sehr kurzer Zeit ein extrem hohes basales Level anzuschlagen.
Sei es, wenn ich eine bestimmte Faktur in meiner Orchestration von einem großen Meister nehme, von Ravel oder Prokofjew, nicht eins zu eins, aber eben übernehme, dann weiß ich erst einmal, die klingt. Genauso ist es, wenn wir spielen.
Ich habe eine bestimmte Stelle im Kopf, in der Version von jemandem in Werk XY und höre sie mir ganz genau an, um dem möglichst nah zu kommen. Das funktioniert kurzzeitig ganz gut, aber man büßt einfach sehr an Individualität ein. Es ist so gefährlich.
Keiner von uns braucht es, eine Kopie zu sein.
Wenn ich weiß, dass ich dieses Werk in den nächsten Wochen zu spielen habe, höre ich mir um Himmels willen keine Aufnahme davon an, um keinen Preis. Selbst wenn ich noch ein wenig Input bräuchte, weil ich doch in die Bredouille komme, da ich in wenigen Wochen viele Programme hintereinander hatte und für meine Verhältnisse etwas zu spät mit dem Studium dieses Programmes angefangen habe – dann werde ich mich da durchbeißen und einfach meine Lesart herausfinden, auch wenn es mich Kraft und Tages- und Nachtzeit kostet.
Ich will doch meine Fassung davon finden. Das ist der einzige Grund für mich, warum ich mich mit diesem oder jenem beschäftige.
Das ist ein schöner Schlusssatz.
Ich danke dir sehr.
Danke dir, Robert Neumann.
Das Interview führte Silke Ohlert.

Robert Neumann in der Hochschule für Musik, Hanns Eisler. Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times

Robert Neumann gegenüber der Musikhochschule Hanns Eisler in Berlin vor dem neuaufgebauten Berliner Schloss. Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times
Konzertkalender Januar:
9.–10. Januar 2025 Stuttgart, SWR-Produktion
14. Januar 2025 Stadthalle Hagen, Edvard Grieg, Klavierkonzert a-moll op.16, Philharmonisches Orchester Hagen, Dirigent: Rodrigo Tomillo
18. Januar 2025 Parktheater Bensheim, Rezital
23. Januar 2025 Hannover, NDR Konzerthaus, Duoabend mit Philipp Schupelius


























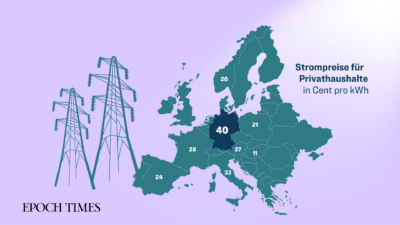





vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion