
Journalisten mit Pulitzer-Preisen gekürt
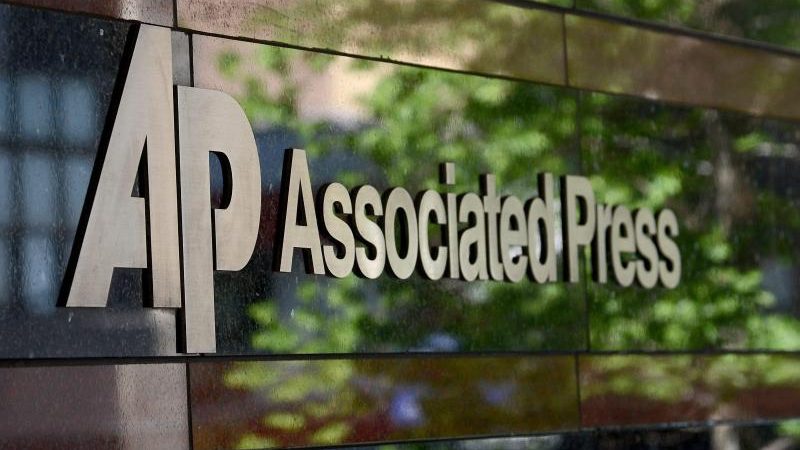
Heute werden seine Worte live im Internet übertragen, auf YouTube, auf Facebook. Die Pulitzer-Preise, die erstmals vor 100 Jahren verliehen wurden, sind im digitalen Jetzt angekommen.
Alte Grundsätze bei der Bewertung journalistischer Arbeit hat die Jury deshalb nicht über Bord geworfen. Wieder sind es beeindruckende Stücke, die sich in den 14 journalistischen Sparten dieses Jahr gegen die Konkurrenz durchgesetzt haben. Allen voran die 18 Monate lange Recherche der Nachrichtenagentur AP, die Licht ins Dunkel der von Sklavenarbeit durchwachsenen Fischerei-Industrie in Südostasien brachte. Die Reporter versteckten sich in Myanmar tagelang auf der Ladefläche eines Lastwagens und schmuggelten eine Kamera auf ein Schiff, um mehr über die gnadenlose Ausbeutung der bitterarmen Arbeiter zu erfahren.
Wieder sind es die ganz großen US-Blätter, die Preise absahnen. Die „Washington Post“ etwa, die mit einer Datenbank zeigt, wie häufig und warum Polizisten in den USA auf Menschen schießen und wer die Opfer sind. Oder die „New York Times“-Journalistin Alissa Rubin, die die tägliche Gewalt gegen Frauen in Afghanistan schildert, wo eine 27-Jährige im März von einem Mob geschlagen, durch die Straße gezerrt und dann verbrannt wurde. Auch Journalisten der „Los Angeles Times“ und der Zeitung „Boston Globe“ sind unter den Gewinnern.
Mit der unabhängigen Institution ProPublica und dem Marshall Project, das sich für Journalismus zum Strafrechtssystem stark macht, sind aber auch weniger berühmte Häuser dabei. Christian Miller und Ken Armstrong haben für eine umfassende Reportage aufgedeckt, wie die Polizei bei der Aufarbeitung von Vergewaltigungen versagt und welche traumatischen Folgen das für die Opfer hat. Auch die „Tampa Bay Times“ ist außerhalb von Florida nicht jedem geläufig, geht mit einem Projekt zur Gewalt in Floridas psychiatrischen Kliniken und einem zu schlechten Schulen in dem Bundesstaat mit zwei Preisen nach Hause.
„Das Spektrum großer Nachrichten in der Welt war durch die Geschichten in der Endrunde gut abgedeckt“, sagt Mike Pride. „Zu den wichtigen journalistischen Herausforderungen wurde eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht.“ Schon in der Vorauswahl dürfte das Durchsieben von rund 1200 eingereichten Arbeiten kein Leichtes gewesen sein. Jeden Frühling versammeln sich 77 Redakteure, Verleger, Schreiber und Lehrkräfte, um in jeder Sparte aus drei Finalisten mehrheitlich einen Gewinner zu bestimmen.
Für Gesprächsstoff sorgt dieses Mal vor allem ein Name: Emily Nussbaum. Die TV-Kritikerin des „New Yorker“ sahnte den mit 10 000 Dollar dotierten Preis in der Sparte für Kritik ab – nur ein Jahr, nachdem Mary McNamara von der „Los Angeles Times“ in derselben Kategorie gewonnen hatte. Gute, von Frauen verfasste Texte über Fernsehen würden zu einer Zeit gewürdigt, in der dort auch weibliche Charaktere und Künstler auf dem Vormarsch seien, schreibt die „Washington Post“. Und das in einem Medium, das sein neues goldenes Zeitalter mit Serien wie „Mad Men“, „Breaking Bad“, „The Wire“ und „Deadwood“ feiert, die besondere Geschichten von Männern erzählen.
(dpa)













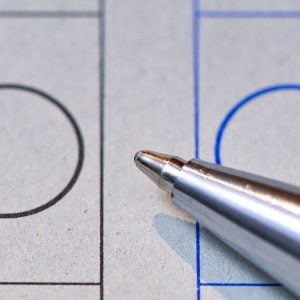













vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion