
Angelina Jolie brilliert als Maria Callas

An ihrer unverwechselbaren, markanten Stimme lässt sie sich schon nach wenigen Takten erkennen. Von schmerzlicher Schönheit ist der Sopran von Maria Callas, besonders dunkel in der Tiefe und noch in den höchsten Registern von einer atemberaubenden, maskulinen Durchschlagskraft.
Keine andere grandiose Sängerin dürfte in der Lage sein, diese Stimme perfekt zu imitieren, geschweige denn eine Schauspielerin – die Bulgarin Sonya Yoncheva ebenso wenig wie Anna Netrebko, Opernstar Nummer eins, deren Sopran zumindest in den tieferen Registern ein wenig an die Primadonna Assoluta erinnert. Es gibt – zum Glück – keine Kopie.

Maria Callas (Angelina Jolie). Foto: STUDIOCANAL GmbH/Pablo Larraín
Theater und Kino ließen sich gleichwohl mehrfach schon von der Ikone inspirieren, wofür Terrence McNallys Bühnenstück „Master Class“ oder der Dokumentarfilm „Maria by Callas“ von Tom Volf beispielhaft stehen mögen. Letzterer räumte sehr eindrücklich mit der falschen Behauptung auf, die Diva habe zahlreiche Auftritte aufgrund von Allüren abgesagt. Vielmehr verausgabte sich die passionierte Tragödin bei ihren Vorstellungen, brannte wie eine Kerze von zwei Seiten und fühlte sich dann zeitweise nicht mehr gut bei Stimme.
Ein fiktionalisiertes Filmporträt stellt freilich vor größere Herausforderungen als eine Dokumentation, und wie Pablo Larraín und seine Hauptdarstellerin diese meistern, ist eine kleine Sensation.
„Maria“ erzählt von den letzten sieben Tagen im Leben der Primadonna Assoluta, die im September 1977 nach einer viereinhalbjährigen Abstinenz von der Bühne erfolglos nach ihrer verlorenen Stimme sucht, bevor im Alter von nur 53 Jahren ihr Herz versagt.
Es ist nach den Filmporträts über Jackie Kennedy und Lady Diana der dritte Teil einer Trilogie über historische Frauen des 20. Jahrhunderts.

Maria Callas (Angelina Jolie) sieht sich mit dem Versagen ihrer Stimme konfrontiert. Foto: STUDIOCANAL GmbH/Pablo Larraín
Minutiöse Nachinszenierung mit Angelina Jolie
Rein äußerlich sieht Angelina Jolie der in New York geborenen Griechin Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulou, wie sie eigentlich mit vollem Namen hieß, sehr ähnlich. Die berühmten Roben der Callas, ihre Frisuren, das Make-up mit dem starken Lidstrich und Accessoires, allen voran die Brille mit den dicken Gläsern, wurden für den Film perfekt nachgebildet.
Und auch die übrigen Akteure vor der Kamera gleichen ihren prominenten historischen Vorbildern, Aristoteles Onassis, Ehemann Giovanni Battista Meneghini, Präsident John F. Kennedy und – in einer Minirolle – Marylin Monroe.
Gleichwohl reduziert Jolie ihre Rolle nicht auf eine bloße Kopie der Jahrhundertsängerin.

Maria Callas (Angelina Jolie) und Aristoteles Onassis (Haluk Bilginer). Foto: STUDIOCANAL GmbH
Vielmehr singt sie mehrfach einige Takte selber und das funktioniert dank eines cleveren Kunstgriffs überzeugend, denn singend gibt Jolie nur die gealterte, tablettensüchtige Callas, die nicht mehr gut singen kann. Wenn ihre Stimme versagt, vollzieht sich in Bild und Ton eine Rückblende in jene Zeit, als Callas im Zenit ihrer Laufbahn stand, und zu hören ist nunmehr eine historische Originalaufnahme mit Callas.
Da bis auf einen Ausschnitt aus dem zweiten Akt von Puccinis „Tosca“ keine Videomitschnitte von der Jahrhundertsängerin auf einer Opernbühne existieren, hat Larraín legendäre Bühnenauftritte der Diva minutiös mit Angelina Jolie nachinszeniert.
Hier sieht man die Aktrice überwiegend im Profil, von hinten oder aus weiter Ferne, zumal auf Bildern, die leicht unscharf und grobkörnig gehalten sind, sodass man sich einbilden könnte, die echte Callas zu sehen.

Angelina Jolie als Opernstar Maria Callas. Foto: STUDIOCANAL GmbH
Singen, ganz für sich allein
Bei alledem erscheint es bemerkenswert, wie achtbar Jolie ihre musikalische Herausforderung nach nur sechs Monaten Gesangsunterricht meistert.
Auf die belastete Jugend in dem von Nationalsozialisten besetzten Athen in den frühen 1940er-Jahren und die leidvolle Liaison mit dem Milliardär Onassis, der ihre Kunst nicht würdigte und das schöne „Singvögelchen“ für die Präsidentenwitwe Jackie Kennedy sitzen ließ, wirft der Film nur kurze, aber aussagekräftige Schlaglichter in schwarz-weißen Rückblenden.
Ihre Würde verliert Maria im Film jedoch nicht. Jolie bewahrt sie ihr allen Erniedrigungen zum Trotz. Das gemeinsame Kind mit Onassis habe sie keineswegs abgetrieben, weil Onassis es von ihr verlangt habe, sondern weil sie kein zweites Ich erschaffen wollte, sagt sie einmal zu einem imaginären Journalisten wie zu sich selbst.
Und wenn sie einen enttäuschten Fan anfaucht, der sich über ihre zahlreichen Absagen von einst beschwert, er habe keine Ahnung von ihrem Beruf, wird sie zu der „Tigerin“, als die man sie von der Bühne kannte.
In der vielleicht bedeutendsten Szene entgegnet sie ihrem Arzt auf die Frage, warum sie sich das Singen trotz ihres schlechten gesundheitlichen Zustands überhaupt noch zumute, dass sie gar nicht vorhabe, noch einmal aufzutreten.
In ihrer Kindheit drängte ihre Mutter sie dazu, Onassis habe ihr das Singen später verboten, und nun, endlich, singe sie ganz für sich allein. Denn ihr Leben ist die Oper, und in der Oper gibt es keine Vernunft.
Sorgfältige Musikauswahl mit subtiler Kennerschaft
Verstanden aber wird Maria eigentlich von niemandem. Einsam lebt sie in ihrer feudalen Pariser Wohnung, in der einzig ihr Butler Ferruccio (Pierfrancesco Favino) und die Haushälterin Bruna (Alba Rohrwacher) samt zweier Zwergpudel als eine Art Ersatzfamilie fungieren.
Ferruccios Hauptaufgabe ist es, nahezu täglich trotz vehementer Rückenschmerzen den Flügel in ein anderes Zimmer zu schieben. Bruna ist in erster Linie für die Küche zuständig und dafür, mit Komplimenten die Illusion aufrechtzuerhalten, ihre Herrschaft sänge noch immer großartig. Streckenweise ist der Film also ein leises, unspektakuläres, intimes Kammerspiel.

Kammerdiener Ferruccio (Pierfrancesco Favino), Maria Callas (Angelina Jolie) (M.) und ihre Köchin sowie Vertraute Bruna (Alba Rohrwacher). Foto: STUDIOCANAL GmbH

Maria Callas (Angelina Jolie): Wenn nur noch die Erinnerung bleibt. Foto: STUDIOCANAL GmbH
Den hohen künstlerischen Anspruch des Films beglaubigen die sorgfältige Musikauswahl, eine subtile Kennerschaft von Callas’ Leben und Wirken und der Soundtrack, der sich nahezu lückenlos über die Bilder legt, als eine reizvolle Partitur: Arien und Orchestervorspiele aus unterschiedlichsten Opern, teils in arrangierten Fassungen für Klavier solo, reihen sich darin aneinander.
Darunter neben überwiegend italienischer Musik ein Ausschnitt aus Wagners „Parsifal“, der daran erinnert, dass Callas auch eine Wagnersängerin war (neben der Kundry hatte sie in italienischer Sprache Isolde und Brünnhilde in ihrem Repertoire), und wie Amfortas in dieser Oper an Wunden litt, die sich nicht schließen ließen.
Jeder Track für sich ist dabei genau abgestimmt auf den szenischen Kontext, Stimmungen und Gefühle.
Das „Ave Maria“ aus Verdis Otello, das Maria Callas zu ihrem Abschied singt, nahm sie nur für die Platte auf. Die Desdemona war die Paraderolle ihrer ewigen Rivalin Renata Tebaldi. So wie das zärtlich traurige Gebet im Film als Leitmotiv Gewicht erhält, wird erst so richtig bewusst, dass Callas es eigentlich noch bewegender gestaltete als die Kollegin, schmerzlich schön wie nur wenige andere.

Die legendäre Operndiva Maria Callas (Angelina Jolie) in einer Szene aus der Oper Tosca, in der sie die Sopran-Arie Vissi d‘arte singt. Foto: STUDIOCANAL GmbH

Plakat zu „Maria“ – ab 6. Februar in deutschen Kinos. Foto: STUDIOCANAL GmbH
„Maria“ – Regie: Pablo Larraín, 124 min, FSK: ab 6 Jahren





![[Live ab 9 Uhr] Pressegespräch der AFD zur Klage gegen GG-Änderung durch alten Bundestag](https://images-de.epochtimes.de/uploads/2025/03/Thumbnail-AfD-Klage-GG-Aenderung-400x225.jpg)















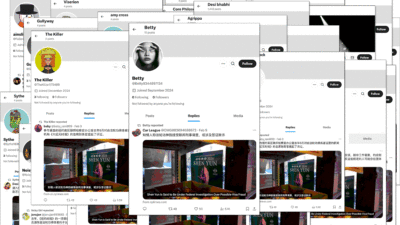







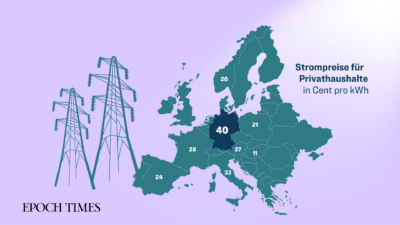
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion