
Die stille Epidemie, die die Psyche auffrisst

Billy, ein aufgeweckter zehnjähriger Junge, glänzte in der Schule mit hervorragenden Noten. Allerdings fiel es ihm schwer, mit sozialen Situationen umzugehen.
Auch war er ein schlechter Verlierer. Bei Brettspielen oder bei Gruppenaktivitäten neigte Billy dazu, zu lügen und zu schummeln, und zeigte bei Niederlagen heftige emotionale Ausbrüche. Seine Freunde, die er schon seit Kindergartenzeiten kannte, begannen, ihre Geduld zu verlieren. Billys Eltern erkannten, dass etwas getan werden musste.
Sie wandten sich an die Kinderpsychiaterin Dr. Victoria Dunckley, die sich auf die Auswirkungen von Bildschirmnutzung bei Kindern spezialisiert hat.
Unter ihrer Anleitung begann Billy ein vierwöchiges „Bildschirm-Fasten“, welches die vollständige Eliminierung aller Fernseh-, Handy- und Videospielaktivitäten beinhaltete. Billys Verhalten verbesserte sich nach dieser Maßnahme dramatisch. Überzeugt von den positiven Ergebnissen entschieden sich seine Eltern, die Bildschirmauszeit beizubehalten.
Billy gehört zu den zahlreichen Patienten von Dr. Dunckley, bei denen sich gezeigt hat, dass psychische und Verhaltensprobleme verschwinden, wenn die Zeit vor Bildschirmen deutlich eingeschränkt oder auf null reduziert wird.
Eine stille Epidemie: Anstieg der Bildschirmzeit
Der exzessive Gebrauch von Bildschirmen hat sich zu einer stillen, aber weitreichenden Epidemie entwickelt, die das Leben vieler Menschen unbemerkt beeinträchtigt. Laut einer Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2012 gaben etwa 60 Prozent der jungen Erwachsenen in den USA an, zu viel Zeit im Internet zu verbringen. Eine spätere Umfrage im Jahr 2022 zeigte, dass 83 Prozent der Smartphone-Nutzer ihr Handy „fast immer“ bei sich haben.
In Deutschland verbringen deutsche Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren laut der Jugend-Digitalstudie der Postbank rund 64 Stunden pro Woche im Internet. Dies ist weniger als im Vorjahr (68 Stunden), aber bleibt über dem Niveau vor der Pandemie (58 Stunden im Jahr 2019). Unter Einbeziehung von Smart-TVs und Spielekonsolen erhöht sich die durchschnittliche Zeit vor Bildschirmen auf etwa 70 Stunden pro Woche.

Jugendliche verbringen laut einer Studie der Postbank rund 64 Stunden pro Woche im Internet. Foto: iStock
Viele Menschen verbringen ihre Freizeit mit Aktivitäten am Bildschirm wie dem Anschauen von kurzen Videos, Filmen, Fernsehserien, der Nutzung von sozialen Medien oder dem Spielen von Videospielen. Diese Formen der Bildschirmunterhaltung bieten oft ein ähnliches Erlebnis: Man entdeckt Neues und wird dafür belohnt. Dies kann gleichzeitig stressig und befriedigend sein.
Das Problem dabei ist, dass die ständige Bildschirmnutzung unser Gehirn überstimulieren kann, was zu anhaltendem Stress führt, der auch als Kampf-oder-Flucht-Reaktion bekannt ist. Dieser Zustand beansprucht das Gehirn und den Körper stark und macht uns anfälliger für emotionale Zusammenbrüche, Depressionen und Angstzustände, selbst bei kleineren Veränderungen in der Umgebung.
Zunahme psychischer Probleme bei Jugendlichen
Jean Twenge, eine Psychologieprofessorin an der San Diego State University in Kalifornien, stellte anhand von Studien, die verschiedene Generationen untersuchten, eine Verbindung zwischen langer Bildschirmzeit und der Zunahme von psychischen Störungen bei Jugendlichen fest. Besonders nach 2010 beobachtete Twenge einen ungewöhnlich starken Anstieg solcher Fälle. Während zwischen 2005 und 2012 depressive Episoden bei 12- bis 17-Jährigen nur um ein Prozent anstiegen, zeigte sich zwischen 2012 und 2017 ein deutlicher Anstieg um fast 4 Prozent.
Auch etwa ab dem Jahr 2010 registrierten Forscher einen dramatischen Anstieg der Nutzung sozialer Medien und des Internets unter Jugendlichen. Gleichzeitig zeigte sich ein deutlicher Rückgang bei Aktivitäten im Freien und dem Lesen von Büchern.
In Deutschland hat sich die Zahl der vollstationären Krankenhausbehandlungen aufgrund von Depressionen bei unter 15-Jährigen seit dem Jahr 2000 mehr als vervierzehnfacht, von 410 Fällen auf 5.790 im Jahr 2017. In der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen erhöhte sich die Zahl von 5.200 auf etwa 34.300, was fast einer Versiebenfachung gleichkommt.
Psychotherapeut Tom Kersting, der 25 Jahre als psychologischer Berater an Schulen arbeitete, meint: „Es geht nicht nur um die Länge der Zeit, die die Kinder in der virtuellen Welt verbringen“, betont Kersting, „sondern auch um die Erfahrungen, die sie dabei verpassen: das Spielen an der frischen Luft und das Erlernen sozialer Kompetenzen.“
Studien zur Internetabhängigkeit bei Kindern während der Pandemie sind rar, doch eine umfangreiche US-amerikanische Erwachsenenstudie aus dem Jahr 2021 ergab, dass Personen, die als gefährdet für Internetsucht galten, ein 2,3-mal höheres Risiko für Depressionen und ein 1,9-mal höheres Risiko für Angstzustände hatten als der Durchschnitt der Bevölkerung. Bei schwerer Sucht stieg dieses Risiko sogar um das 13-Fache.
In der Post-Corona-Zeit berichten Lehrkräfte in den USA von Herausforderungen mit der jüngsten Generation – der Generation Alpha, auch bekannt als „iPad-Kinder“. Diese zeigen im Unterricht häufig aggressives und unbeherrschtes Verhalten und haben Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu regulieren.
Dr. Clifford Sussman, der sich auf Bildschirmsucht spezialisiert hat, hat aufgrund des wachsenden Bedarfs seinen Schwerpunkt auf die Behandlung dieser Störung gelegt. „Nach der Pandemie hat die Nachfrage nach Hilfe bei diesem Problem regelrecht einen Boom erlebt.“
Wie Bildschirme uns fesseln
Bildschirmaktivitäten – egal ob es sich um Videospiele, soziale Medien, Internetsurfen oder Videostreaming handelt – bieten eine Flucht aus dem Alltag. Diese Aktivitäten sind für das Gehirn aufgrund ihrer leuchtenden Farben und nahtlosen Integration in die virtuelle Welt besonders stimulierend, erklärte der Medizinprofessor und Psychotherapeut Dr. David Rosenfeld von der Universität Buenos Aires.
Wird das Gehirn mit etwas Neuem und Aufregendem konfrontiert, schüttet es Dopamin aus; und alles, was zur Dopaminausschüttung führt, kann süchtig machen. Dopamin erzeugt ein Gefühl von Wohlbefinden, während eine Reduktion mit Antriebslosigkeit und schlechter Stimmung in Verbindung gebracht wird.
Bildschirmaktivitäten sind so konzipiert, dass sie unsere Aufmerksamkeit fesseln, indem sie uns regelmäßig Dopamin „liefern“. Ähnlich wie beim Spielen eines fesselnden Videospiels, das einen Nervenkitzel auslöst, wenn ein neues Level erreicht, ein Gegner besiegt oder ein neuer Gegenstand gefunden wurde, verführen Bildschirme dazu, mehr Zeit in der virtuellen Welt zu verbringen.

Videospiele bieten eine Flucht aus dem Alltag. Foto: iStock
„Videospiele werden von mikroskopischen Regeln gesteuert“, sagte Bennett Foddy, der an der New York University Spielentwicklung unterrichtet, in dem Buch „Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked“ von Adam Alter, wie vom „Guardian“ auszugsweise zitiert wurde.
Diese Mikro-Regeln können etwa ein „Ding“-Geräusch oder ein weißer Blitz sein, der erscheint, wenn ein Spielcharakter ein bestimmtes Feld betritt. Sie sind auf die Aktionen des Spielers abgestimmt, sodass dieser das Gefühl bekommt, er habe es verursacht. Das Mikro-Feedback erzeugt ein Belohnungsgefühl und hält die Spieler dazu an, kontinuierlich zu spielen.
Dieses System könnte auch erklären, warum interaktive Bildschirmaktivitäten für Kinder problematischer sein könnten als passive wie Fernsehen.
Dr. Dunckley hat beobachtet, dass zwar zwei Stunden Fernsehen bei Kindern Anzeichen von Regulationsstörungen hervorrufen, aber bereits 30 Minuten interaktiver Bildschirmaktivitäten ausreichen, um Anzeichen zu zeigen.
Das Taubenexperiment
Videospiele nutzen häufig Methoden, die auch beim Glücksspiel Anwendung finden. Ein typisches Beispiel sind sogenannte Beutekisten – virtuelle Schatzkisten, die Spielern zufällige Belohnungen gewähren. Das Besondere dabei ist, dass die Spieler nicht vorhersagen können, wann sie die nächste Belohnung erhalten werden. Diese Vorfreude schafft eine starke Anziehungskraft, die die Spieler dazu verleitet, weiterzuspielen, auch wenn sie eigentlich keinen Spaß mehr daran haben.
Diese Strategie stammt von den Arbeiten des Psychologen Burrhus Frederic Skinner. Skinner setzte Tauben in einen Kasten mit einem Knopf und belohnte sie mit Futter, wann immer sie darauf drückten. Er stellte fest, dass Tauben, die per Zufallsprinzip belohnt wurden, stärker dazu getrieben waren, den Knopf zu drücken, als jene, die bei jedem Drücken belohnt wurden.
Diese Zwanghaftigkeit existiert auch beim Menschen.

Roulette. Foto: iStock
Soziale Medien wiederum zerlegen Informationen in kleine Häppchen und versorgen die Nutzer bei jedem Beitrag, jedem Like und jedem Kommentar mit einem Dopamin-Stoß. Ferner sind sie so gestaltet, dass sie die natürlichen Stoppsignale, die man normalerweise in vielen Bereichen des Lebens vorfindet, nicht aufweisen.
Ob es sich um einen Zeitungsartikel, ein Buch oder einen Film handelt, stoßen wir an ein Ende – wie der letzte Absatz, das letzte Kapitel oder das Filmende. Man muss sich daher für eine andere Aktivität entscheiden. Bei sozialen Medien kann man jedoch endlos weiterscrollen.
Das Surfen im Internet folgt einem ähnlichen Muster. Wenn man ein Stichwort in eine Suchmaschine eingibt, erscheinen unzählige Ergebnisse. Diese Fülle an Informationen kann dazu führen, dass wir uns leicht verlieren – ohne ein klares Ende in Sicht zu haben.
Wenn Bildschirmzeit das echte Leben verdrängt
In unserer Gesellschaft sind Bildschirme so allgegenwärtig und akzeptiert, dass vielen gar nicht bewusst ist, wie sehr ihre Bildschirmnutzung überhandnimmt.
Es gibt zwar keine festen Richtlinien dafür, was als exzessive Bildschirmnutzung gilt, doch immer mehr Daten weisen darauf hin, dass das Bildschirmverhalten vieler Jugendlicher problematisch ist.
Hilarie Cash, Mitbegründerin des US-amerikanischen reSTART Life Therapiezentrums für Technikabhängigkeit, sagte, dass eine Bildschirmnutzung dann als problematisch gilt, wenn sie uns die für das normale menschliche Funktionieren notwendige Zeit raubt.
Menschen benötigen täglich etwa acht Stunden Schlaf und verbringen durchschnittlich 8,5 Stunden bei der Arbeit oder in der Schule. Zudem benötigen sie Zeit für soziale Kontakte, Sport, Essen, Körperpflege, tägliche Routinen und Hobbys. Sieben Stunden Bildschirmzeit täglich bedeutet also, dass wesentliche Aktivitäten zu kurz kommen.
Dino Ambrosi, Gründer eines 12-wöchigen Programms, das Studenten hilft, die Zeit in den sozialen Medien einzuschränken, schätzte in einem TEDx-Vortrag, dass die meisten 18-Jährigen, wenn sie 90 Jahre alt würden, nur noch 334 Monate Freizeit in ihrem Leben hätten.
Was sie mit dieser Zeit anfangen, „wird wortwörtlich bestimmen, welche Art Mensch sie werden“, so Ambrosi. Seinen Schätzungen zufolge verbringen sie jedoch rund 93 Prozent dieser Zeit hinter Bildschirmen – und das meist unbeabsichtigt.
Cash, die seit den 1990er-Jahren Menschen behandelt, die mit Internetpornografie- und Videospielsucht kämpfen, stellt eine beunruhigende Entwicklung fest.
Ihre früheren Patienten hatten trotz ihrer Bildschirmsucht ausreichende Lebensfertigkeiten. Heute mangelt es vielen ihrer Klienten jedoch an grundlegenden Kompetenzen wie Kochen, persönlicher Hygiene, Gesprächsführung, Aufbau von Beziehungen und vielem mehr. Diese Menschen sind deutlich schwieriger zu behandeln.
Ein Grund hierfür ist, dass sie schon früh in ihrer Kindheit oder Jugend ein Mittel zum Entfliehen aus der Realität in die Hand bekamen. Dadurch sind sie zu Menschen geworden, die regelmäßig vor Unannehmlichkeiten und Herausforderungen des Lebens flüchten. Laut Cash haben sie Schwierigkeiten, soziale Bindungen einzugehen, Herausforderungen zu bewältigen und einen Job zu behalten – alles entscheidend für ein erfülltes Leben außerhalb der digitalen Welt.
Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „The Silent Epidemic Eating Away American Minds“. (deutsche Bearbeitung kr)





















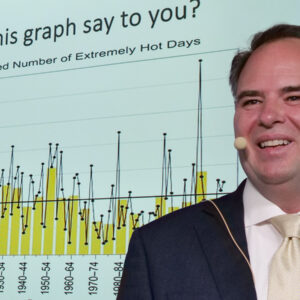







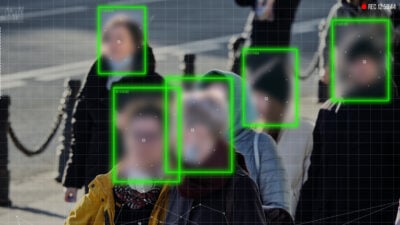


vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion