
Wolfgang Bosbach über Politikverdrossenheit, Helden und was wirklich zählt im Leben

Dr. Sandra Maxeiner , Politik- und Sozialwissenschaftlerin, Autorin, Coach, schreibt auf der Webseite „Was wirklich zählt im Leben“, über Menschen, die Vorbilder sein können, die soziales Engagement zeigen und aktiv gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Hier ihr Bericht über den Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach.
Als ich überlegte, ob ich für meine Reihe „Was wirklich zählt im Leben“ einen Politiker interviewen soll, ist mir sofort Wolfgang Bosbach in den Sinn gekommen. Wie kein anderer Politiker steht Wolfgang Bosbach für Glaubwürdigkeit, Geradlinigkeit, Authentizität und für Menschlichkeit in der Politik. Er ist einer der wenigen Politiker, die sich nie „verbogen“ haben, einer, der seine Überzeugungen nie aus falsch verstandener Loyalität verraten oder Parteiinteressen geopfert hat – auch dann nicht, wenn ihm der Gegenwind stark ins Gesicht blies. Kurz: Wolfgang Bosbach ist ein Vorbild – nicht nur für Nachwuchspolitiker, sondern für viele Menschen in unserem Land; so auch für mich.
 Dr. Sandra Maxeiner, Gründerin der Förderkreises "Was wirklich zählt im Leben"Foto: Maxeiner
Dr. Sandra Maxeiner, Gründerin der Förderkreises "Was wirklich zählt im Leben"Foto: MaxeinerEs ist nun schon fast siebzehn Jahre her, dass ich jung und ambitioniert genug war, um mir vorzustellen, einmal in die Politik einzusteigen. Schnell musste ich damals jedoch feststellen, dass Fleiß, Idealismus und Engagement allein nicht ausreichten, denn es ist vor allem eines, was man hier mehr denn je braucht: Ellbogen. Schon bald verstand ich, wie viel Wahrheit doch in dem alten Spruch "Feind, Todfeind, Parteifreund" steckte.
Gerade als ich für Traudl Herrhausen – einer der aufrichtigsten, integersten, ehrlichsten und warmherzigen Menschen, mit denen ich je zusammenarbeiten durfte – während meines Studiums arbeitete, bekam ich mit, wie Politik wirklich funktioniert. Ziemlich schnell war für mich klar: Das ist nichts für mich! Eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereut habe, auch wenn mich zuweilen etwas Wehmut überkommt, sobald ich hin und wieder „politische Luft“ schnuppere.
Als ich an diesem Montag mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof fahre und zu Fuß den Weg über die Fugängerbrücke über die Spree hin zum Paul-Löber-Haus gegenüber dem Kanzleramt gehe, tue ich das mit durchaus gemischten Gefühlen. Zugleich bin ich ungeheuer gespannt, wie wohl der Mensch Wolfgang Bosbach jenseits des Bildes, das die Medien von ihm zeichnen, wirklich ist. Wenig später gehe ich durch die Sicherheitskontrolle, bekomme einen Besucherausweis und warte darauf, dass ich abgeholt werde. Kirsten Sittig, seine Sekretärin, die mich sofort mit ihrer ausgesprochen natürlichen, herzlichen und zugewandten Art für sich einnimmt, begleitet mich nach oben, in sein Büro. Und während wir ein wenig über ihre Arbeit plaudern, merke ich sofort: Kirsten Sittig ist einer der wenigen Menschen, die das, was sie tun – ähnlich wie ihr Chef – mit Leidenschaft tun.
Wolfgang Bosbach empfängt mich freundlich und während unseres Gespräches lerne ich einen Menschen kennen, der auf mich kämpferisch, pointiert, geradlinig, menschlich, zugewandt, glaubwürdig und bodenständig wirkt. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass genau dieser Mensch der Politik noch lange erhalten bleibt.
Herr Bosbach, Sie sind einer der wenigen Politiker, die von ihren Wählern dafür geschätzt werden, dass sie ihrem Gewissen folgen und authentisch und glaubwürdig für ihre Überzeugungen eintreten. Sie geben, so schrieb der Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers, Peter Pauls, „der Politik ein menschliches Gesicht“. Was müsste aus Ihrer Sicht geschehen, damit wieder mehr Menschen Vertrauen in die Politik entwickeln und die sogenannte Politikverdrossenheit wieder einem echten Interesse der Wähler weicht?
 Wolfgang Bosbach, CDU, einer der wenigen Politiker, die von ihren Wählern dafür geschätzt werden, dass sie ihrem Gewissen folgen und authentisch und glaubwürdig für ihre Überzeugungen eintreten.Foto: © www.manfredesser.de
Wolfgang Bosbach, CDU, einer der wenigen Politiker, die von ihren Wählern dafür geschätzt werden, dass sie ihrem Gewissen folgen und authentisch und glaubwürdig für ihre Überzeugungen eintreten.Foto: © www.manfredesser.deWenn man das Wort Politikverdrossenheit wortwörtlich auslegt, würde es bedeuten, dass heute viel weniger Menschen politisch interessiert sind als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Das ist aber nicht der Fall. Das politische Interesse ist heute genauso groß wie in der Vergangenheit auch. Doch die Kluft zwischen Wählern und Gewählten, die wird immer größer. Wir haben ein hohes Maß an Parteienverdrossenheit, das stimmt – und ein hohes Maß an Politikerverdrossenheit, das stimmt leider auch. In Deutschland sind knapp zwei Prozent der Bürger Mitglieder in einer Partei, aber das politische Interesse ist doch viel höher.
Entscheidend ist die Übereinstimmung von Wort und Tat – es darf nach der Wahl nichts anderes gelten als wir den Menschen vor der Wahl gesagt haben. Politik muss verlässlich sein, Politiker müssen glaubwürdig sein, nicht nur in ihrer politischen Sacharbeit, sondern auch durch ihr öffentliches Auftreten, und vor allen Dingen müssen wir uns viel mehr Mühe geben, zu begründen, warum wir welche politischen Entscheidungen treffen. In der Regel ist es so: Wir beschließen und verkünden. Richtig wäre: Zuerst begründen und dann beschließen.
Da schließt sich gleich meine nächste Frage an: Sind Sie der Meinung, dass wir wieder zurückkommen müssten zu einem anderen Politikertypus, der nicht vor allem eigene, nämlich Machtinteressen, um jeden Preis verfolgt, sondern Politik aus Überzeugung und Leidenschaft betreibt? Und können wir diesen Typus finden, wenn Parteien ihre Kandidaten wieder breiter aussuchen und auch Quereinsteigern eine Chance geben?
Interessant ist, dass es tatsächlich auch heute noch Parteien gibt, so auch die SPD bei mir zuhause, die ihre Kandidaten nicht durch die Mitglieder in Urwahl nominieren, sondern durch ein Delegiertensystem. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich 1994 der erste CDU-Kandidat war, der in einer Urabstimmung gewählt worden ist. Ich hatte damals zwei Gegenkandidaten. Davor hatten wir ein 60er Delegiertengremium. Auf einmal waren über 600 Mitglieder in einer Turnhalle versammelt. Es gab eine leidenschaftliche Debatte, die der ganzen Partei Aufschwung gegeben hat. Ich kann nur dazu raten, die Nominierung der Kandidaten auf eine ganz breite Basis zu stellen. Ich gebe allerdings sofort zu, dass man in einem Delegiertengremium besser klüngeln kann. Das heißt, das Ergebnis ist vorhersehbarer als bei der Mobilisierung von Mitgliedern.
Ja, wir müssen auch offen sein für Quereinsteiger. Aber ein gewisses Maß an politischer Erfahrung sollte nicht fehlen. Man muss jetzt nicht unbedingt die berühmte Ochsentour machen – so wie ich sie gemacht habe: Junge Union, Plakate kleben, im Wahlkampf Flugbätter verteilen, sich bei Wind und Wetter die Füße an Ständen platt stehen. Aber ein kontinuierliches politisches Interesse – auch Erfahrungen zum Beispiel in der Kommunalarbeit – sind für die Arbeit im Bundestag unerlässlich. Es käme ja auch niemand auf die Idee zu sagen: "Wir müssen den Arztberuf jetzt mal für Quereinsteiger öffnen". Ein gewisses Maß an medizinischen Kenntnissen erwartet der Patient schon, wenn er das Sprechzimmer betritt.
Die "Zeit" hat Sie in einem Artikel als Held bezeichnet und Sie in eine Reihe gestellt mit dem Tunesier Mohammed Bohazizi , der sich aus Protest gegen seine Regierung verbrannte und damit Proteste des sogenannten Arabischen Frühlings auslöste, und dem US-Soldaten Bradley Manning, der wegen Geheimnisverrates an die Enthüllungsplattform Wikileaks zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Was bedeutet es für Sie, für andere Menschen ein Held – oder zumindest ein Vorbild – zu sein und wie gehen Sie damit um?
Held genannt zu werden, ist mir eigentlich peinlich, weil die gerade genannten Personen im Gegensatz zu mir ein hohes Risiko auf sich genommen haben. Vielleicht bin ich so eine Art Held wider Willen; ich möchte nur bei dem bleiben, was ich den Menschen gesagt habe! Ich möchte den geraden Weg gehen und schrecke auch nicht vor Widerständen zurück. Das ist alles, dadurch wird man – zumindest nach meiner Überzeugung – nicht zum Helden.
Ein Vorbild zu sein, freut mich sehr, das höre ich auch sehr oft, insbesondere von jungen Kolleginnen und Kollegen. Da muss ich einschränkend immer hinzufügen: Die Unabhängigkeit, auch die Souveränität, gewinnt man in erster Linie durch das Vertrauen im Wahlkreis. Und da ist es nun mal im Bergischen Land einfacher als im Ruhrgebiet, zumindest für einen CDU-Kandidaten. Was uns Abgeordnete wirklich frei macht, ist nicht das Grundgesetz – „der Abgeordnete ist an Aufträge und Weisungen nicht gebunden“ –, sondern das große Vertrauen zu Hause und dass man weiß, auch wenn man mal in Berlin gegen den Strom schwimmt, auch wenn es mal Ärger mit der obersten Heeresleitung gibt, zu Hause wirst du getragen und unterstützt. Das macht dich unabhängig.
Das heißt, mit der Vorbildfunktion kommen Sie eher zurecht als mit der Bezeichnung „Held“?
Damit komme ich eher zurecht. Aber wenn jemand an seine eigene, ganz andere persönliche Situation denkt, kann ich das auch verstehen. Da wird es einige geben, die sagen „Ja, der Bosbach hat’s gut, der hat 58,5 Prozent bekommen, wenn ich mich mächtig anstrenge, bekomme ich vielleicht 35 Prozent. Ich werde dennoch nicht direkt gewählt“. Das kann ich nachvollziehen, das ist eine andere Lage.
In Ihrer Biografie „Jetzt erst recht!“ sagen Sie: „Selbstverständlich muss der Mensch im Sinne praktizierter Nächstenliebe ebenfalls Verantwortung für die übernehmen, die sich selbst nicht helfen können.“ Wie sollte nach Ihrer Meinung diese Verantwortung aussehen und was können wir tun, damit sich wieder mehr Menschen verantwortlich fühlen?
Ein ehemaliger Stadtdirektor der Stadt Bergisch Gladbach, Otto Fell, den ich seit Jahrzehnten kenne und der auch mein Stadtdirektor war, als ich zwanzig Jahre Mitglied des Rates der Stadt Bergisch Gladbach war, hat eine sehr interessante Biografie geschrieben mit dem Titel „Hilf dir selbst und hilf den anderen“. Das heißt, wenn wir in allen schwierigen Lagen darauf warten, dass jemand vorbei kommt und uns hilft, werden wir oft einsam bleiben. Man muss sich auch ein bisschen selbst anstrengen und versuchen, Probleme zu meistern und aus schwierigen Situationen aus eigener Kraft herauszukommen. Wer es nicht schafft, der braucht Hilfe. Das ist ganz klar. Deshalb: „Hilf dir selbst und hilf den anderen.“
Wie Menschen am besten Verantwortung übernehmen können, da kann man keinen generellen Vorschlag unterbreiten, denn der eine ist von morgens bis abends eingespannt und hilft mit Geld. Der andere engagiert sich lieber persönlich, so wie meine Frau bei Inner Wheel, einer großen, internationalen rotarischen Frauenvereinigung: Das ist ganz persönliches, soziales Engagement. Jeder muss selbst wissen, was das Richtige für ihn ist und was im Bereich seiner Möglichkeiten liegt.
Meiner Überzeugung nach ist es ein Irrtum zu glauben, es gäbe nicht mehr die solidarische Gesellschaft und wir wären jetzt auf dem Weg in die Ellbogengesellschaft. Es gibt in unserem Land viel mehr stilles, unentdecktes ehrenamtliches Engagement als man es landläufig vermutet, auch ohne dass die Leute großes Aufheben darum machen.
Sie haben unter anderem vom Düsseldorfer Freundeskreis Heinrich Heine einen Preis für Zivilcourage bekommen, weil Sie sich sehr mutig für Gerechtigkeit und Aufklärung einsetzen. Was bedeutet Zivilcourage für Sie ganz persönlich?
Dass man zum einen zu seiner Meinung steht, auch wenn es auch mal Gegenwind gibt, dass man auch versucht, in der Öffenlichkeit deutlich zu machen, warum man eine bestimmte Position vertritt und dass man auch bereit ist, persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Denn ich erlebe es zu oft, dass jemand sagt: „Nee, das lasse ich lieber sein, das gibt nur Ärger“. Das mag ja sein. Doch häufig ist es so, dass man wirkliche Unterstützung erst dann erfährt, wenn das eigene Engagement öffentlich wird. Dann kommen viele und sagen: „Jawohl, das sehe ich genauso. Richtig so“. Man glaubt oft, man sei in einer Minderheitenposition, aber man ist es gar nicht.
Brauchen wir mehr Menschen wie Dominik Brunner, die anderen selbstlos in Notsituationen beistehen? In welchen Situationen sollten Menschen Zivilcourage zeigen und wann ist es besser, erst einmal an sein eigenes Leben zu denken und daran, sich selbst zu schützen und nicht einfach einzugreifen, ohne zu überlegen?
Mut und Vorsicht gehören zusammen. Dominik Brunner hat in einer schwierigen Situation Mut bewiesen. Er hat ja nicht nur sein Leben riskiert, sondern es auch verloren. Aber „Mann gegen Mann“ ist etwas anderes als wenn man als 70-jährige Großmutter nur mit der Handtasche bewaffnet vier Hooligans gegenübersteht. Da kann ich niemandem empfehlen, sich mutig ins Getümmel zu stürzen. Man muss schon erkennen, wann man sich selbst überfordert und selbst ein Risiko eingeht, ohne seine Lage dadurch irgendwie lösen oder beherrschen zu können. Mut und Vorsicht gehören zusammen. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt „Ich würde gerne helfen“, aber in bestimmten Situationen dann doch entscheidet, „Ich kann es aber nicht“. Dann muss man sich aber darum bemühen, Hilfe zu organisieren.
Oftmals erleben wir Situationen, die geradzu paradox sind – dass beispielsweise bei einer Schlägerei fünfzig Personen zusehen. Weil alle denken, „Warum ich, warum ausgerechnet ich? Es sind ja noch neunundvierzig andere da." Da hat man sich eine prima Entschuldigung zurecht gelegt, warum man jetzt selbst nichts getan hat, wenn der Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung erhoben wird. Wer um Hilfe bitten oder wirklich helfen möchte, dem kann ich nur folgendes empfehlen: Wenn man mehrere Personen sieht, nicht sagen „Hilfe, Hilfe“, sondern Menschen direkt ansprechen: „Sie da, mit dem schwarzen Lodenmantel oder Sie mit der Aktentasche, warum helfen Sie nicht?“ Dann sagen die Angesprochnenen: „Ja, Moment mal, jetzt bin ich ja gemeint“. Da können sie nicht mehr auf die anderen zeigen, sondern müssen sich fragen: „Wieso habe ich den Hilferuf nicht gehört?“ Je mehr es sind, die Hilfe leisten könnten, desto einfacher ist es, sich in der Menge zu verstecken.
Das heißt, das Wichtigste ist, die Menschen einzubeziehen, sie anzusprechen?
Ganz genau. Damit jeder sich betroffen fühlt, und keiner sagen kann, es seien ja noch genügend andere hier. Es sind ja auch Aussagen, die wir halb schmunzelnd registrieren, in denen aber leider ein Körnchen Wahrheit steckt, wie zum Beispiel: „Einer trage des anderen Last, du musst nur sehen, dass du der andere bist.“, oder: „Wenn jeder an sich selbst denkt, ist auch an jeden gedacht“. Das sind so schöne Kalauer, aber darin steckt natürlich der Gedanke, „Wieso ich?“ Wenn jeder im Ehrenamt fragen würde „Warum ich?“, gäbe es ehrenamtliches Engagement in dieser Form nicht. Eine beliebte Antwort, wenn man fragt, ob jemand Mitglied der Partei werden möchte, ist auch immer: „Was habe ich davon?“ Wenn man so an eine Sache herangeht, braucht man gar nicht erst anzufangen.
Nach dem christlichem Menschenbild sind wir alle Geschöpfe Gottes. Darin begründen sich zum einen der Wert und die Würde eines jeden Menschen und zum anderen auch die Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens. Im Grundsatz ist dieses Menschenbild ein sehr schönes und sollte unser Handeln leiten. Doch gibt es nicht auch Bereiche – gerade am Ende unseres Lebens – wenn Menschen sterben und furchtbare Schmerzen erleiden müssen, in denen wir auch akzeptieren müssen, dass sie selbst entscheiden können und dürfen, wann es genug ist und wann ihr Leben zu Ende sein soll?
Genauso ist es ja auch. Der Patient entscheidet über Beginn, Fortgang und Beendigung einer medizinischen Therapie. Die Ärzte können aufklären, sie können einen Rat geben, sie können gemeinsam mit dem Patienten etwaige Risiken abwägen, aber die Entscheidung liegt beim Patienten. Selbst wenn der Patient möglicherweise eine objektiv unvernünftige Entscheidung trifft, trifft nur er selbst diese Entscheidung und nicht der Arzt an seiner Stelle.
Ich wollte eigentlich eher auf den Begriff der Sterbehilfe – aktiv oder passiv – hinaus und auf die Frage, ob man da nicht eher eine Liberalisierung der derzeitigen Regelungen braucht, damit jeder Mensch ganz individuell die Gewissensfrage für oder gegen Sterbehilfe beantworten kann.
Passive Sterbehilfe ist rechtlich unproblematisch. Es wird leider von verschiedenen Interessengruppen der Eindruck erweckt, als sei es in Deutschland gar nicht möglich, ohne Schmerzen zu sterben – als sei unser Recht inhuman, weil wir elementare Patientenrechte missachten würden. Dabei ist das Gegenteil richtig. Ich muss wirklich lachen, wenn jeden Tag gefordert wird, die Deutschen mögen doch eine ähnliche Rechtslage haben wie die Schweiz. Denn Deutschland und die Schweiz haben beim Thema passive und aktive Sterbehilfe exakt die gleiche Rechtslage, auch wenn oft Gegenteiliges kolportiert wird. Anders sieht es bei der aktiven Sterbehilfe aus, also bei Tötung auf Verlangen. Da gibt es in der Tat rechtliche Unterschiede. Allerdings nicht zwischen Deutschland und Schweiz, aber zwischen Deutschland und den Niederlanden. Und da muss man sich entscheiden, denn die Tür ein bisschen aufzumachen, ist bei aktiver Sterbehilfe ein Ding der Unmöglichkeit. Entweder sie ist auf oder sie bleibt verschlossen.
Beispiel: Es wird gefordert, aktive Sterbehilfe zu erlauben, aber nur bei besonders schweren Erkrankungen. Wer bitte schön bestimmt darüber, was eine besonders schwere Erkrankung ist? Soll der Deutsche Bundestag einen Katalog von Krankheiten beschließen, bei dem aktive Sterbehilfe erlaubt werden oder verboten bleiben soll? Wenn man diese Tür einmal öffnet, wenn "Du sollst nicht töten" nicht mehr gilt und wenn der Arzt zum Dienstleister in punkto Sterbehilfe werden soll, wird man diese Tür nie mehr zubekommen. Im Gegenteil, es wird immer weitere Bestrebungen geben, die Tür noch weiter zu öffnen, weil immer neue Fälle geschildert werden, in denen man doch bitte aktive Sterbehilfe zulassen sollte. Genau das ist die Erfahrung der niederländischen Debatte.
In der Schweiz ist es meines Wissens im Gegensatz zu Deutschland möglich, einem Menschen zu einer Selbstötung zu verhelfen – wenn der, der danach verlangt, gewisse Voraussetzungen erfüllt, wie beispielsweise, dass er eine zum Tode führende Krankheit (die von einem Arzt attestiert sein muss) nachweist.
Das ist ein anderes Kapitel: Sie meinen die Tätigkeit von Organisationen, die die Selbsttötung ermöglichen. Aktive Sterbehilfe heißt Tötung auf Verlangen. Man tötet einen anderen Menschen – das ist in der Schweiz dem Arzt genauso verboten wie in Deutschland. Was Sie meinen, ist die Tätigkeit sogenannter Sterbehilfeorganisationen, die die Möglichkeit der Selbsttötung unter bestimmten Voraussetzungen organisieren, die Sie gerade zutreffend beschrieben haben. Das ist – de lege lata – heute in Deutschland genauso möglich wie in der Schweiz auch. Und wird ja auch bei uns leider praktiziert. Ich unterstütze einen Gesetzentwurf, der das Ziel hat, die geschäftsmäßige Vermittlung der Selbsttötung zu verbieten.
[–Was bedeutet Mitmenschlichkeit für Sie ganz persönlich?–]
Kommen wir noch einmal zurück auf das Thema Mitmenschlichkeit: Was bedeutet Mitmenschlichkeit für Sie ganz persönlich?
Hilfe denjenigen gegenüber, die sich nicht selbst helfen können. Davon streng zu unterscheiden ist das Leben auf Kosten anderer Menschen. Wir haben selbstverständlich die humanitäre Verpflichtung, die man auch aus dem christlichen Gebot der Nächstenliebe ableiten kann und ableiten muss, denen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können und die dringend der Hilfe von anderen bedürfen. Aber Leben auf Kosten anderer Leute, das ist etwas anderes.
Ihr Lebensmotto – so habe ich es in Ihrer Biografie gelesen – ist von Erich Kästner und lautet „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ In welchen Bereichen würden Sie sich mehr Mitmenschlichkeit und soziales Engagement wünschen?
Ich finde diesen Satz deshalb so prägnant, weil ich in meinem Leben zu vielen Menschen begegnet bin, die immer gesagt haben „Da müsste man …“. Was heißt hier eigentlich „man“? Wer das Wörtchen „man“ verwendet, meint doch bitte den anderen. Da muss jeder wissen, wo er seine individuellen Schwerpunkte setzt. Die ändern sich auch. Zur Zeit, ganz aktuell, ist es die Betreuung bei der Eingliederung von Flüchtlingen. Wir haben 2008 28.000 Flüchtlinge aufgenommen, 2014 203.000, wir rechnen in diesem Jahr mit über 400.000 Flüchtlingen. Das ist eine gewaltige Leistung des Staates. Aber zu dieser organisatorischen Leistung des Staates sollte auch das persönliche Engagement der Bürger hinzukommen. Und wir erleben da gerade bei Kriegsflüchtlingen eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft. Das ist für mich vorbildliches Engagement, damit diejenigen, die Schutz suchen und Schutz bekommen, auch das Gefühl haben, dass sie in ihrem neuen Heimatland auch wirklich willkommen sind.
In einem Grußwort für den Bundesverband Lebensrecht schrieben Sie: „Wie wir mit den Schwachen und den Sterbenden […] umgehen, wird zum Gradmesser der Mitmenschlichkeit in unserer Gesellschaft werden“. Welche Veränderungen sind aus Ihrer Sicht nötig, damit Mitmenschlichkeit wieder breiter in unsere Gesellschaft hineingetragen wird?
Es muss sich flächendeckend die Erkenntnis durchsetzen, dass wir alle in bestimmten Phasen unseres Lebens auf die Hilfe von anderen angewiesen sind – mal mehr und mal weniger. Mal für einen kurzen Zeitraum, mal für einen längeren Zeitraum. Dass wir die Augen weit aufmachen für die, die uns nahestehen, für die, die uns anvertraut sind, aber auch für diejenigen, zu denen wir vielleicht keine persönliche Beziehung haben, die aber in unserem näheren Umfeld leben und denen wir täglich begegnen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Das Paradebeispiel war früher der Milchmann, der bemerkt hat, dass jemand seit Tagen die Milch nicht mehr hereingeholt hat. Heute ist es der Briefträger, der sieht, dass der Briefkasten überquillt und dann eben nicht einfach weitergeht, und die Post noch mit letzter Kraft reinstopft, obwohl er es vielleicht nicht muss, sondern bei Nachbarn klingelt und fragt: „Was ist denn mit der alten Frau Müller, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen?“
Was würden Sie Menschen raten, die darüber nachdenken, sich sozial zu engagieren, aber noch nicht wissen, was das Richtige für sie ist?
Informieren! Es gibt eine Fülle von Veranstaltungen, Messen, Börsen, wo sich diese Organisationen vorstellen und händeringend um Nachwuchs für die ehrenamtliche Arbeit werben. Ich halte es für völlig legitim, wenn jemand sagt: „Ich möchte mich zunächst erst einmal umfangreich informieren, was es alles für Angebote und Möglichkeiten gibt und will mir dann etwas raussuchen, was ich auch wirklich gerne machen möchte“. Lieber etwas zögern und dann länger dabei bleiben als das erstbeste Angebot annehmen und dann nicht erfüllt sein. Eine gute Bekannte von uns engagiert sich schon seit langer Zeit sehr intensiv für die Tafel. Ihre Begeisterung, mit der sie sich dort engagiert zeigt mir, dass diese Sache ihr wirklich am Herzen liegt. Es ist keine Freizeitbeschäftigung, sondern ein echtes Anliegen.
Sie haben einmal gesagt: „Eines habe ich gelernt: Niemals aufgeben. Es geht immer weiter!“ Was ist es, das Ihnen Mut, Zuversicht und Hoffnung gibt, dass Sie sich so entschlossen gegen Ihre Erkrankung stemmen können und mit soviel positiver Energie weitermachen?
Die sichere Gewissheit, dass ich nicht gesünder und fröhlicher werde, wenn ich den Kopf hängen lassen würde, wenn ich langsamer laufen, nur noch kürzere Strecken gehen würde – es ginge mir garantiert nicht besser. Ich habe das große Glück, beruflich das machen zu können, was ich immer schon gerne machen wollte. Mehr Glück kannst du im Beruf gar nicht haben. Und wenn man das – wenn auch mit etwas eingeschränktem Pensum, trotz zweier chronischer Erkrankungen – noch leisten kann, ist das ein Grund zur Freude.
[–Ist für Sie eventuell ein Rückzug aus der Politik denkbar?–]
Sie haben bei Günther Jauch angedeutet, dass für Sie eventuell auch ein Rückzug aus der Politik unter bestimmten Voraussetzungen denkbar ist. Was bleibt, wenn Sie Ihre große Leidenschaft, die Politik, gehen lassen?
Nein, die Politik werde ich nie ganz aufgeben. Es ist im Grunde heute so, wie bereits seit 43 Jahren: Montags morgens lese ich immer als erstes den Sportteil, dann die Politik, an allen anderen Tagen ist es genau umgekehrt. Aber das Interesse wird bleiben. Diese Leidenschaft wird bleiben, auch das Engagement für die CDU. Viele reduzieren ja auch die Arbeit von Politikern auf das Auftreten in Talkshows oder anderen Sendungen. Das ist maximal ein Prozent unserer Arbeit, 99 Prozent sind nicht öffentlich. Und das ist mit einem so großen Aufwand an Zeit und Kraft verbunden, dass man sich fragt: „Brauchst du das noch? Muss das jetzt noch unbedingt sein?“ Und da komme ich immer mehr zu dem Ergebnis: In dem Umfang, wie ich es mache, muss es nicht mehr sein.
Eine Frage, die sich mir gestellt hat, als ich Ihre Biografie gelesen habe: Es ist zwar schade, dass Sie das Karrierziel, Bundesinnenminister zu werden, nicht erreicht haben, doch ist es auf der anderen Seite nicht tröstlich, wenn Sie wissen, dass Sie in den Herzen vieler Menschen viel mehr erreicht haben?
Wunderschön festgestellt. Genauso sehe ich das auch. Ein schöneres Kompliment kann es eigentlich gar nicht geben. Viele Kollegen sagen ja auf die Frage: „Wären Sie gern Minister geworden?“: „Ich, nein! Ich bin hochzufrieden …“. Das ist alles Quatsch. Es klingt zwar sehr bescheiden, aber ich jedenfalls glaube sowas nicht, jedenfalls nicht bei denen, die Vollblutpolitiker sind. Ich wär’s gerne geworden, ich bin’s nicht geworden. Aber die Zuneigung von Menschen – so ein tolles Wahlergebnis wie bei der letzten Bundestagswahl – ist doch mehr wert als jedes Ministeramt. Meine Mutter hat immer gesagt: „Junge, wer weiß, wofür es gut ist“, dass ich es nicht geworden bin. Und Mama hat völlig recht: Jede Medaille hat zwei Seiten. Allerdings hätte ich es gern als Herausforderung gesehen, auch weil ich mir die Möglichkeit erhofft habe, einen anderen Stil in die Politik zu bringen. Aber es wäre auch der letzte Rest von Freiheit und Freizeit verloren gegangen.
Wie möchten Sie anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Ich brauche keine Straße, die nach mir benannt ist, und auch kein Denkmal. Wenn die Leute sagen: „Netter Kerl, der mehr getan hat, als nur seine Pflicht“, bin ich hoch zufrieden. Es gibt eine Zeile aus einem Lied von Reinhard Mey, die finde ich sehr sympathisch, weil sie schlicht und einprägsam ist und sie würde zudem auch auf meinen Grabstein passen: „Hier liegt einer, der höchst ungern, aber der zufrieden ging.“
Herr Bosbach, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch!
Quelle: Was wirklich zählt im Leben










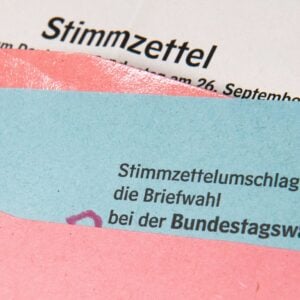

















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion