
Roland Kaiser sagt trotz KaiserMania: „Ich muss mich nicht als Held aufspielen“

Aus Anlass der legendäre „KaiserMania“, die heute im Rahmen der Filmnächte in Dresden stattfindet, veröffentlichen wir das Interview von Sandra Maxeiner mit Roland Kaiser vom Mai dieses Jahres, das einen nachdenklichen und engagierten Menschen zeigt.
Seine „kaiser“liche Open-Air-Party, die „KaiserMania“ feiert zwölfjähriges Bestehen: Vier Termine gibt es in diesem Jahr erstmals, heute, am 31. Juli und am 1. August sowie am 7. und 8. August. Alle sind ausverkauft, aber am 1. August wird im MDR die Veranstaltung unter dem Titel „Sommer bei uns – KaiserMania 2015“ ab 19:50 Uhr live übertragen.
 Dr. Sandra Maxeiner, Gründerin der Förderkreises „Was wirklich zählt im Leben"Foto: Maxeiner
Dr. Sandra Maxeiner, Gründerin der Förderkreises „Was wirklich zählt im Leben"Foto: MaxeinerDr. Sandra Maxeiner, Politik- und Sozialwissenschaftlerin, Autorin, Coach, schreibt auf der Webseite des Förderkreises „Was wirklich zählt im Leben“ über Menschen, die Vorbilder sein können, die soziales Engagement zeigen und aktiv gesellschaftliche Verantwortung übernehmen:
Es waren Roland Kaisers unvergessliche Melodien, die mich durch meine Teenagerzeit im sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat DDR begleitet und mir so manche triste, manchmal hoffnungslose Zeit bunter und lebenswerter gemacht haben.
Mit seinen Liedern konnte ich dem verhassten Einheits-Grau, den Parolen der sozialistischen Kader und dem vom Staat in ebenso sorgfältiger wie beängstigender Art und Weise vorgezeichneten Leben zumindest einige Augenblicke lang entfliehen. Mit seiner „Midnight Lady", konnte ich mich wegträumen oder "zu den Sternen", in eine ferne, eine bessere Welt „fliegen"… Und dass diese eines Tages kommen würde, habe ich immer gehofft. Als die Mauer am 9. November 1989 endlich fiel, erfüllte sich damit für mich ein lang gehegter Wunsch.
Und nun treffe ich in dem kleinen Hotel in Münster ein. Ich suche mir eine ruhige, gemütliche Ecke in der Hotelbar und dann kommt er auch schon: Roland Kaiser. Lässig steht er vor mir, lächelt mich an und sieht mit seinen Jeans, den Turnschuhen und dem blauen Schal unverschämt jung aus. [Anm. der Das Gespräch fand am 18. Mai statt.]
Kaiser spricht schnell, emotional und man spürt, dass ihm soziale Themen wirklich am Herzen liegen. Er ist ein ausgesprochen empathischer Mensch, bei dem ich von Anfang an wahrnehme, dass er echtes Interesse an seinem Gesprächspartner hat. Immer wieder fragt er nach, will wissen, was ich denke oder was mich umtreibt.
Maxeiner: Sie engagieren sich u. a. für die Albert-Schweitzer Kinderdörfer und -Familienwerke, für die Stiftung Lesen, sind Botschafter für das Kinderhospiz Mitteldeutschland, der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Sie setzen sich für Organspenden ein und engagieren sich seit einiger Zeit auch für die Rudolf-Pichlmayr-Stiftung. Allein die Liste Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten ist beeindruckend. Wie bekommen Sie all das unter einen Hut und welches Engagement liegt Ihnen ganz besonders am Herzen?
Kaiser: Abstufen will ich das gar nicht. Man kann das zeitlich gut hinbekommen, indem man sich auf die Dinge konzentriert, die im Jetzt liegen. Im Moment interessiert mich nichts weiter als das Gespräch mit Ihnen. Nicht das, was morgen kommt, nicht das, was gestern war. Da lebe ich wie ein Kind und interessiere mich nur für das, was aktuell ansteht. Wenn man abstufen möchte, gibt es natürlich Dinge, die mir aufgrund meiner eigenen Situation sehr nahe sind.
Dazu gehört die Tätigkeit als Botschafter für die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Aber gleichzeitig bin ich in der Sozialfond-Stiftung NRW seit über 20 Jahren aktiv, 10 Jahre davon im Vorstand. Weil mir junge Menschen, ihre Förderung und ganz besonders die Wiedereingliederung von arbeitslosen jungen Menschen am Herzen liegt. Denn sie können nur dann den ersten Arbeitsmarkt erreichen, wenn sie eine gute Schulausbildung bekommen.
Doch viele Eltern können genau das nicht bezahlen. Und hier versuchen wir, regulierend einzugreifen und Chancengleichheit mit den Kindern herzustellen, die aus Elternhäusern kommen, die ihnen genau das ermöglichen. Auch das Kinderhospiz Mitteldeutschland liegt mir sehr am Herzen. Man muss nur einmal da gewesen sein, um zu wissen, wie wichtig solche Einrichtungen und die Arbeit der Menschen dort sind.
Maxeiner: Als Beispiel für Ihr soziales Engagement möchte ich die Rudolf-Pichlmayr-Stiftung herausgreifen, die Kinder vor und nach Organtransplantationen betreut. Wie kamen Sie in Kontakt mit dieser Stiftung?
Kaiser: Teile der Stiftung sind engagiert in der Medizinischen Hochschule Hannover, dort, wo mir eine Lunge transplantiert wurde. Durch meinen Freund Frank Walter Steinmeier, der im Vorstand tätig ist, bin ich in Kontakt mit der Stiftung gekommen und finde die Idee großartig, Kinder, die auf Organe warten oder solche, die bereits transplantiert sind, im Rehazentrum Ederhof zu betreuen und ihnen die Chance zu geben, wieder zurück ins Leben zu finden.
Denn die Erkrankung dieser Kinder ist eine große Belastung für ihre Familien, ganz besonders für ihre Geschwister und ihre Eltern, die häufig ihr Hauptaugenmerk auf das kranke Kind richten, den Geschwistern aber gerade dadurch das Gefühl geben, ein Stück zurückgesetzt zu sein. Indem sie die Familien aufnimmt und sie auch psychologisch betreut, leistet die Rudolf-Pichlmayr-Stiftung eine unschätzbar wertvolle Arbeit.
Maxeiner: Sie haben einige der Kinder, die von der Rudolf-Pichlmayer-Stiftung im Rehazentrum Ederhof betreut werden, besucht. Wie haben Sie diese Kinder erlebt? Wie gehen sie mit ihrer Erkrankung um und welche Gefühle hatten Sie bei der Begegnung mit ihnen?
Kaiser: Ich habe dort transplantierte Kinder getroffen, die lebensfroh und heiter waren. Kinder machen sich nicht so viele Gedanken wie wir Erwachsenen – sie gehen mit ihrer Erkrankung sehr viel pragmatischer um: Sie sagen nicht „Ich bin transplantiert", sondern „Ich bin geheilt". Dass sie ihr Leben lang Immunsuppressiva nehmen müssen, stört sie nicht. Sie fühlen sich wohl und strahlen das auch aus.
Maxeiner: Haben Sie auch Kinder vor deren Transplantation getroffen?
Kaiser: Bisher noch nicht. Denn vor einer Transplantation ist es ja nochmal eine ganz besondere Situation. Oft muss man lange warten, was nicht nur für das Kind selbst, sondern für die gesamte Familie eine große Belastung ist.
Maxeiner: Gab es in der Zeit, in der Sie sich für die Rudolf-Pichlmayr-Stiftung engagieren, ein Schicksal eines Kindes, das Sie besonders berührt hat?
Kaiser: Nicht personifiziert, nein. Ich bin für die Stiftung vor allem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Letztes Jahr habe ich beispielsweise bei den "Eagles" gastiert; das ist ein Charity-Golfclub, der unglaubliche Summen zusammenspielt und diese an förderungswürdige Projekte weitergibt. Viele Prominente engagieren sich dort und spenden jedes Jahr viel Geld. Ich habe dort mit meiner Band einen Unplugged-Auftritt gehabt und den Erlös der Rudolf-Pichlmayr-Stiftung überreicht. Es waren 30.000 Euro, und das hat große Freude im Hause Pichlmayr ausgelöst.
 Roland Kaiser besucht Kinder im Ederhof, Rudolf-Pichlmayr-StiftungFoto: © Robert Weichselbraun
Roland Kaiser besucht Kinder im Ederhof, Rudolf-Pichlmayr-StiftungFoto: © Robert WeichselbraunMaxeiner: Warum liegen Ihnen Kinder besonders am Herzen?
Kaiser: Kinder schützen uns davor, uns über die Maßen wichtig zu nehmen. Jeder Mensch hält sich ja selbst für den Mittelpunkt der Welt. Aber mit einem Kind kommt man plötzlich an den Rand des Kreises und wird ein bisschen normaler, geerdeter. Gerade in meinem Beruf, wo man schnell mal hofiert und auch glorifiziert wird, läuft man Gefahr, dass man irgendwann wirklich glaubt, dass man so wichtig ist, wie der letzte Applaus war.
Maxeiner: Was macht man, damit das nicht passiert?
Kaiser: Man normalisiert sich. Ich sage mir immer, ich bin maximal bereit, „Primus inter pares", also "Erster unter Gleichen" zu sein, aber nur für kurze Zeit. Danach möchte ich wieder ich selbst sein dürfen. Kinder machen das ganz toll mit Ihnen. Ich bin mal nach einem großen Konzert nach Hause gekommen und wollte gerade meiner Tochter davon erzählen, wie toll es war, als sie zu mir sagte: „Du hast mir versprochen, mit mir Mathe zu machen".
Dann musste ich mich hinsetzen und mit ihr rechnen. Dadurch bin ich so geerdet, dass ich mich nicht so wichtig nehme. Denn was ich mache, ist keine Operation am offenen Herzen. Ich singe nur ein bisschen und kann manchmal zweieinhalb Stunden Menschen das Gefühl geben, mal Pause zu haben von all dem Stress, der sie umgibt, und schicke sie dann mit einem guten Gefühl nach Hause. Mehr tue ich nicht. Ich verbessere die Welt nicht und rette auch kein Leben.
Maxeiner: Sie waren selbst lebensbedrohlich erkrankt. Inwiefern hat sich Ihre Einstellung zum Leben und zum Tod geändert?
Kaiser: Nicht durch meine Erkrankung, aber durch meine Gesundung hat sich eine ganze Menge verändert. Ich bin entspannter als früher. Ich kann Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden und habe gelernt, Nein zu sagen. Und ich rege mich auch nicht mehr so auf wie früher. Denn das, was wir täglich manchmal für so wichtig erachten, ist im Vergleich mit einer ernsten, lebensbedrohlichen Situation in der Regel unwichtig. Auch habe ich heute weniger Sorgen, Fehler zu machen.
Früher war ich deutlich aufgeregter und hab‘ jede Bühne mit dem Wunsch nach Perfektion betreten. Heute sage ich mir: "Ich gebe das Beste, das ich habe. Und wenn es nicht reicht, Pech gehabt." Das macht mich ruhiger und relaxter.
Maxeiner: Es muss ein gutes Gefühl sein, wenn man entspannter mit beruflichen Situationen umgehen kann, oder?
Kaiser: Deutlich, ja. Früher habe ich mir mehr Sorgen gemacht, heute sage ich mir: "Na gut, auch Fehler sind menschlich."
Maxeiner: Hat Ihnen, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, auch Ihre Zeit geholfen, die Sie mit den Kapuzinermönchen verbracht haben?
Kaiser: Ich hab‘ sie ab und an besucht und manchmal besuchen sie auch mich. Es war und ist ein reger Austausch über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Wir reden über das Leben, über die Gesellschaft, über aktuelle Entwicklungen und über den Glauben. Die Kapuzinermönche sind tolle Menschen, die mit viel innerer Ruhe arbeiten. Das finde ich fantastisch.
Maxeiner: Gibt es weitere wichtige Erkenntnisse, die Sie in diesen Gesprächen gewonnen haben?
Kaiser: Ja, denn wenn Sie diesen Menschen gegenüber sitzen, merken Sie sofort: sie sind einfach weniger getrieben als man selbst. Sie müssen nicht Erster sein, müssen nicht gewinnen. Sind nicht auf der Jagd nach Erfolg oder Statussymbolen. Sie haben einfach eine andere Lebenseinstellung. Sie ruhen viel mehr in sich selbst als wir es vermutlich jemals können. Dennoch leben sie im Heute und im Jetzt, mit all den Dingen – auch Smartphones – , mit denen auch wir leben.
Maxeiner: Sie setzen sich u. a. auch dafür ein, dass Menschen sich trauen, offener mit ihrer Erkrankung umgehen.
Kaiser: Das ist mir ganz wichtig, denn ich bin überzeugt, dass, wenn Menschen andere über ihr Handicap informieren, diese ihnen auch helfen und sie unterstützen können. Das ist nicht möglich, wenn sie schweigen und so tun als seien sie nach wie vor stark. Wenn Sie beispielsweise nicht mehr richtig laufen können und ein Problem mit ihrem Fuß haben, es aber keinem sagen, müssen sie, wenn sie etwas vergessen haben, es selbst holen. Sie humpeln also drei Kilometer hin und wieder zurück und sind dann vollkommen fertig.
Wenn sie jedoch sagen würden: "Ich würde eine Arbeit verrichten, die im nahen Umfeld ist, denn ich habe ein Fußproblem", wird man ihnen helfen. Hätte ich meinem Regisseur früher gesagt: "Ich hab‘ ein Problem mit dem Atmen", hätte er mich nicht durch die Halle gehetzt. Aber ich war ja so stark, dass ich immer gesagt habe: "Ich kann das alles." Aus dieser Erfahrung heraus rate ich Menschen: „Sagt, wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr ein Handicap habt, denn es ist dann leichter für eure Mitmenschen, damit umzugehen".
Maxeiner: Glauben Sie, dass das auch ein Weg sein könnte für Menschen, die an Depressionen leiden?
Kaiser: Das ist ein schwieriges Thema, weil man Menschen mit Depressionen auch nicht erkennt. Sie haben keine äußerlichen Merkmale. Man merkt es nur an ihrem Verhalten, dass sie aus sozialen Kontakten fliehen und die Einsamkeit suchen. Oft weiß man gar nicht, wo das herkommt. Und so werden diese Menschen häufig als geisteskrank oder „verrückt" bezeichnet, was natürlich Unsinn ist.
Ich glaube, dass auch unsere Gesellschaft und unsere Lebensweise daran schuld sind, dass es immer mehr depressive Erkrankungen gibt: Niemand leistet sich mehr den Luxus zur Ruhe zu kommen, niemand darf schwach sein, jeder muss gewinnen, erfolgreich sein und persönliche Schicksalsschläge müssen einfach hingenommen und möglichst stillschweigend ertragen werden.
Wenn sie sich heute einen Termin bei einem Psychiater geben lassen, haben sie ein halbes Jahr Wartezeit, bis sie einen Therapieplatz bekommen. Früher waren auch die sozialen Kontakte intakter. Da gab es auch mal einen Tratsch mit dem Nachbarn, man konnte sein Päckchen Sorgen einfach leichter mal loswerden und loslassen. Heute dürfen die Menschen mit niemandem darüber reden, schon gar nicht in der Firma.
Denn gerade dort dürfen sie keine Schwächen zeigen, sonst denkt ihr Chef sofort: "Oh, die Frau Müller, die ist angeknackst, der können wir keine Aufgaben mehr geben, nichts mehr zutrauen. Dann schauen wir doch mal, wann sie die nächsten Fehler macht, damit wir sie abmahnen und kündigen können." Die Angst heute ist groß, in der Gesellschaft nicht bestehen zu können. Und wenn die Menschen erst einmal auf der Flucht aus der Gesellschaft sind, haben sie verloren.
Wahrscheinlich ist das offene Reden immer am besten – wenn man sich das traut. Beginnen sollten depressive Menschen – denke ich – bei ihrem Partner, wenn der es noch nicht gemerkt hat. Denn manche Partner sind blind und sagen dann „Stell dich doch nicht so an, es geht dir doch gut". Schließlich geht es ihnen äußerlich doch gut – sie sind finanziell abgesichert. Es gibt auch depressive Menschen, die mehrfache Millionäre sind.
Maxeiner: Was müsste sich aus Ihrer Sicht im Umgang mit kranken Menschen, mit Menschen, die unserer Hilfe bedürfen, ändern, damit sie den Mut haben, sich zu öffnen?
Kaiser: Man müsste ihre Probleme ernst nehmen und sie nicht als „harmlos" abtun. Man müsste sich mit ihnen hinsetzen und zuhören. Gerade das Zuhören ist eine große Kunst. Denn wenn sich jemand seinen Frust von der Seele reden kann, erkennt er seine Probleme oft selbst. Wenn ich in meinem Umfeld einen Menschen hätte, der depressiv wäre, würde ich mich einfach mit ihm hinsetzen, mir Zeit nehmen, ihn reden lassen und zuhören.
Auf keinen Fall würde ich ihn unter Stress setzen. Denn das ist das Schlimmste, dass man jemanden, der depressiv ist, zumuten kann. Man darf jemanden, der die einfachen Dinge seines Alltags nicht mehr bewältigen kann, nicht dazu drängen, über Hürden zu springen. Er muss selber springen wollen. Ihn zu schubsen, wäre falsch.
[–Nur jemand, der auch Schwäche zeigt, kann stark sein–]
Maxeiner: Die depressiven Männer, die ich in einer Selbsthilfegruppe getroffen habe, haben mir oft gesagt: „Ich will das nicht länger, ich will nicht mehr stark sein müssen, ich will, dass mich endlich jemand sieht, wie ich wirklich bin." Ist es wirklich eine Schwäche, wenn man sich das eingesteht?
Kaiser: Nur jemand der auch Schwäche zeigt, kann stark sein. Für mich zeigen diejenigen Menschen wahre Größe, die auch Fehler zugeben können. Auch in der Erziehung meiner Kinder hat mich das immer geleitet. Wenn sie mich beispielsweise gefragt haben: „Papa, wie schnell ist Lichtgeschwindigkeit?", hab‘ ich geantwortet: „Ich glaube 300.000 Meter pro Sekunde, aber lass‘ uns nachschauen, ich weiß es nicht genau." Das fanden sie ganz toll, denn viele Eltern ihrer Klassenkameraden antworten dann auf solche Fragen einfach irgendwas, nur um sich nicht einzugestehen, dass sie es nicht wissen.
Das ist unnötig, ich muss mich nicht als Held aufspielen. Dass ich nicht perfekt bin und es auch nicht sein muss, ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich finde es wichtig, dass man gerade im Umgang mit anderen Menschen seine eigene Unvollkommenheit zugibt. Auch zu sagen "Das kann mir nie passieren" ist vermessen. Denn wer von uns kann schon wissen, was einem alles im Leben zustößt? Der eine hat Glück und der andere nicht. Dinge, die manche Menschen belasten, belasten mich nicht.
Viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die auf Tournee gehen und in einer riesigen, ausverkauften Halle spielen müssen, bekommen Panik. Natürlich könnte ich dann locker sagen: „Reg‘ dich nicht so auf", muss ich aber nicht. Ich kann sie einfach in Ruhe lassen. Wir haben beispielsweise einen Schlagzeuger, der immer nervös herumrennt wie ein Tiger im Käfig, mit schweißigen Fingern und nicht versteht, wie ich vor einem Auftritt entspannt in einer Ecke stehen und Witze erzählen kann.
Jeder Mensch ist anders. Warum soll ich dann zu ihm sagen: „Stell‘ dich nicht so an."? Dann stürze ich ihn noch tiefer in die Unruhe. Also lasse ich ihn einfach in Ruhe und nehme ihn ernst. Menschen so lassen zu können, wie sind, und sie so zu sehen, wie sie wirklich sind, ist eine große Fähigkeit.
Maxeiner: Stichwort Toleranz: Was meinen Sie dazu?
Kaiser: Ja, und zwar nicht nur politisch oder wenn es um Diskriminierung geht, sondern generell. Auch den eigenen Kindern gegenüber tolerant sein, sie ein Stück weit loslassen können. Ich finde es toll, dass meine Kinder einen Vater haben, der voller Fehler steckt, aber – wie sie sagen – auch voller Stärken. Letztendlich hat jeder Mensch ein Spektrum von Fähigkeiten. Oft fragen mich Journalisten, ob ich eigentlich ein positiver Mensch sei. Dann denke ich: "Was stellt ihr mir da für eine blöde Frage?" Niemand ist immer nur positiv oder negativ – manchmal ist man es und manchmal nicht.
Maxeiner: Neben einer Depression gibt es ja viele andere chronische, lebensbedrohliche Erkrankungen. In Ihrer Biografie schreiben Sie, dass es wichtig sei, dass Menschen mit einer chronischen Erkrankung nicht aufgeben, sich nicht unterkriegen lassen und kein hilfloses, in ihr Schicksal ergebenes Opfer werden. Welche Bedeutung hat für Sie Hoffnung und was würden Sie Menschen mit auf den Weg geben, die die Hoffnung verloren haben?
Kaiser: Glaube und Hoffnung helfen, und sind insoweit schon sehr wichtig. Doch nur sie allein reichen nicht aus, um etwas zu bewegen. Man muss schon ein Stück weit selbst zur Veränderung seiner eigenen Situation beitragen. Man kann nicht alles in die Hand der Ärzte oder in die Hand Gottes legen. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Erkrankung habe und es Möglichkeiten gibt, mich zu Wehr zu setzen, muss ich sie nutzen.
Das gilt in vielen Bereichen. Ich habe einige Menschen in meinem privaten Umfeld mit niederschmetternden Diagnosen, die ihnen klar machten, dass ihr Leben bald zu Ende gehen würde. Manche von ihnen ließen sich fallen und andere wehrten sich. Die, die sich wehrten, überlebten in der Regel. Ich selbst bin ein lebendes Beispiel dafür, dass das eigene Wollen und positives Denken manchmal auch Unmögliches möglich machen kann.
Vielleicht kommt bei mir auch noch etwas Entscheidendes dazu, das mich angespornt und mir eine enorme Kraft verliehen hat: Mein Beruf ist mein Hobby und macht mir unendlich viel Spaß! Ich habe keinerlei negativen Stress. Und wenn mich etwas stresst, dann schaffe ich es ab!
(Gute Einstellung…)
Das habe ich von meiner Frau gelernt. Sie zitiert oft einen Vers von Wilhelm Busch:
„Wenn mir aber was nicht lieb,
weg damit! ist mein Prinzip".
Das heißt, Dinge, die einen wirklich stressen, muss man einfach abschaffen. Und ich habe auch keine Lust mehr, mich mit Menschen zu beschäftigen, die mich nerven. Ich habe gelernt, „Nein!" zu sagen – höflich, aber ich sage es. Das konnte ich früher nicht.
(Es ist auch schwierig, das zu lernen …)
Ja! Aber es ist gut für’s Leben!
Maxeiner: Ich komme mal zurück auf unser eigentliches Thema heute: Ihr soziales Engagement, das Ihnen so sehr am Herzen liegt. Sie schreiben dazu in Ihrer Biografie: „Wir sollten wieder eine Gesellschaft werden, die sich mehr am Menschen und weniger am Geld orientiert." Wie genau stellen Sie sich eine solche Gesellschaft vor und was müsste sich ändern, damit das nicht nur ein frommer Wunsch bleibt?
Kaiser: Zum Beispiel, indem wir soziale, helfende Berufe wieder stärker in den Fokus rücken, und diese auch wieder stärker honorieren und uns nicht mehr ausschließlich auf’s Materielle und den Vermögenszuwachs ausrichten. Gerade soziale, helfende Berufe müssen im gesellschaftlichen Ansehen wieder wachsen. Früher waren die wichtigsten Menschen in einem Dorf der Lehrer, der Apotheker, der Arzt, der Pfarrer, der Bürgermeister. Heute haben die Deutschen nur noch wenig für ihre Lehrer übrig, wenig Vertrauen, wenig Respekt und auch das Image des Lehrerberufes ist schlecht.
Doch warum ist es so? Sind es doch gerade die Lehrer, die unseren Nachwuchs und damit unsere Zukunft in der Hand haben. Auch ständig unterbewertet wird die Arbeit von Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern. Wir achten diese Berufe zu wenig, sowohl vom Status her, den wir ihnen beimessen, als auch von der finanziellen Entlohnung.
Wir müssen diese sozialen und helfenden Berufe wieder höher honorieren. Aber das hinzubekommen, ist – nicht nur für die Politik – ein hartes Stück Arbeit, da haben Sie völlig Recht. Es klingt zwar schön, verlockend und populär, dass unsere Gesellschaft sich wieder mehr am Menschen und weniger am Geld orientieren soll, doch es ist leider nur sehr schwer vermittelbar.
Maxeiner: Immer wieder wird über die deutsche Neidgesellschaft debattiert. Solange sich diese negativen Gefühle so tief in der Gesellschaft verfestigt haben, wird eine Gesellschaft, wie wir sie uns wünschen, wohl doch eher ein frommer Wunsch bleiben?
Kaiser: Ja, das befürchte ich auch, denn ich habe das Gefühl, dass gerade wir Deutschen beim Thema „Neid" eine Goldmedaille gewinnen wollen. Dabei müssen wir vor allem aufpassen, dass wir nicht noch weiter auseinanderdriften – zwischen Habenden und Nicht-Habenden. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass immer mehr wenig verdienen, und immer weniger mehr verdienen – denn das wäre eine Entwicklung, die bereits in Amerika fatale Folgen hat. Wenn wir Wohlstand nicht auf eine breite Basis stellen, kann er nicht funktionieren.
Und wir müssen schauen, dass wir das in die Praxis umsetzen: Dass die Menschen, die für Menschen tätig sind, zumindest so viel verdienen wie die, die für Maschinen oder für finanzielle Dienstleistungen zuständig sind. Eine Krankenschwester sollte nicht weniger verdienen als ein Kfz-Mechaniker. Tut sie aber und zwar deutlich weniger. Gar nicht zu reden von Altenpflegern, die noch schlechter bezahlt werden. Denn was sie leisten, ist wirklich „übermenschlich".
Maxeiner: Weil Sie das Thema „Amerika" angesprochen haben: Ich war schockiert, als ich im Dezember vergangenes Jahr in New York war, und gesehen habe, wie die Menschen dort mit den Schwächsten der Gesellschaft, den Obdachlosen, umgegangen sind. Niemand registriert wirklich einen Obdachlosen, keiner steckt ihm Geld zu … (Ich habe es oft getan, weil ich Nichtstun und Ignoranz einfach nicht ertragen kann.)
Kaiser: Ich gebe diesen Menschen auch Geld und muss mich anschließend dafür jedes Mal rechtfertigen. Immer wieder kommt dann das Gegenargument: „Warum gibst du denen denn Geld? Die kaufen sich doch eh nur Alkohol davon." Und ich entgegne dann: „Aber das weiß ich ja nicht, vielleicht geht sich ja auch einer davon etwas zu essen kaufen." Und solange diese Möglichkeit besteht, bin ich bereit, auch fünf Euro fehl zu investieren.
Maxeiner: Ganz genau. Man hat wenigstens eine kleine Chance etwas Positives zu bewegen …
Kaiser: So ist es. Vielleicht habe ich mich von hundertmal 98mal geirrt. Aber zweimal wenigstens nicht.
Maxeiner: Und diese zweimal waren es wert …!
Kaiser: Das meine ich damit. Deshalb engagiere ich mich auch sehr für die Albert-Schweitzer Kinderdörfer und -Familienwerke. Ich bin jetzt in Cottbus Schirmherr der Tafel geworden und musste dort lernen, dass eben nicht nur die Leute zur Tafel gehen, die Hartz-IV-Empfänger sind. Sondern dass ein Großteil von ihnen normale Rentner und ganz normale Arbeitnehmer sind, die eben nicht genug Rente bekommen und Geld verdienen, um sich und ihren Kindern etwas zu essen zu kaufen.
(Das ist traurig).
Ja, klar. Es gibt es eine ganze Reihe von Familien, bei denen der Vater arbeitet, aber das Geld nicht reicht, um Miete, Strom, Versicherungen und Klamotten für die Kinder zu bezahlen. Und so müssen sie sich Essen und Trinken von der Tafel holen.
(Das sollte so nicht sein!)
Nein. Ich glaube in Deutschland sind eine Million Kinder pro Tag davon betroffen. Und: Die Tafeln werden nicht etwa vom Staat finanziert, sondern dahinter stecken immer private Initiativen, Stiftungen etc. Rewe oder Edeka stellen zwar die Lebensmittel zur Verfügung, die kurz vorm Verfallsdatum stehen, doch die privaten Initiatoren müssen dann sehen, wie die Lebensmittel zu ihnen in die Tafel kommen. Und diese Arbeit übernehmen Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. Sie fahren hin, holen die Lebensmittel ab und verteilen das alles morgens an Bedürftige. Das alles ist ehrenamtliche Arbeit, nichts davon ist staatlich gefördert.
Maxeiner: Das zeigt wieder, wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit ist …
Kaiser: Natürlich. Eine Gesellschaft kann ohne ehrenamtliche Tätigkeit gar nicht existieren. Sei es nun ein Verein, eine private Initiative, und auch unser Staat funktioniert nicht ohne die Mithilfe von Ehrenamtlichen. Es gibt eine ganze Reihe bewundernswerter Menschen und interessanter Leute, die ich bei meinem sozialen Engagement kennengelernt habe. Da ist beispielsweise der ehemalige Chef des Finanzamtes in Cottbus, der früh morgens in der Tafel steht und Essen verteilt.
(Großartig!)
Ja. Diesem Mann geht es ganz gut, er ist finanziell durch seine Pension abgesichert. Und er gibt etwas an die Gesellschaft zurück. Das ist auch eine Grundmotivation: „Ich bin von dieser Gesellschaft auf die Sonnenseite gespült worden, und ich habe gefälligst auch was zurückzugeben." Das muss nicht jeder so sehen, aber ich sehe das so. Ich will auch keine Lorbeeren dafür haben, ich möchte einfach nur in den Spiegel blicken können. Das reicht mir. Deshalb gebe ich auch lieber 98 mal fünf Euro zuviel…
Maxeiner: Was würden Sie Menschen mit auf den Weg geben, die sich sozial engagieren möchten, aber noch nicht wissen, was das Richtige für Sie ist?
Kaiser: Sie sollten versuchen, etwas zu finden, was sie persönlich interessiert. Wenn sie ein gutes Verhältnis zu ihren Großeltern haben und merken, dass diese gebrechlich werden, dann ist es vielleicht der richtige Weg, sich in der Altenpflege einzusetzen. Oder wenn man einen guten Draht zu Kindern hat, kann man sich für Kinder engagieren. Es gibt Tausende von Möglichkeiten und wer will, findet Wege. Und wenn man noch keine Idee hat, kann man ja damit beginnen, sich zu fragen: "Wo liegen meine persönlichen Interessen?"
Das kann dann etwas mit Tieren sein oder auch in einem Kinderhospiz. Nur tun sollte man etwas! Kürzlich war ich im Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz (Thüringer Wald) und bin dort aufgetreten. Wir haben viel Geld eingespielt von den Zuschauern, die dort Eintritt bezahlt haben. Und ich habe ehrenamtliche Mitarbeiter des Kinderhospizes kennengelernt, die Kinder eine Weile begleiten und dann – nach ihrer Begleitung – erst einmal eine Auszeit brauchen, weil sie nervlich am Ende sind. Ich habe großen Respekt vor ihrer Arbeit.
Auch mit den Kindern selbst habe ich gesprochen, und dabei erlebt, dass sie trotz ihres schweren Schicksals oft noch ihre Eltern und auch ihre Geschwister trösten. Sie sagen dann Dinge wie: „Ihr müsst nicht weinen, ich bin ja viel eher beim lieben Gott als ihr." Wenn ich das erlebe, berührt mich das sehr, und es macht mich demütig. Denn in solchen Situationen lernt man, eigene Sorgen zu relativieren und sich selbst nicht so wichtig zu nehmen.
Maxeiner: Was ist es denn, was wirklich zählt am Ende des Lebens?
Kaiser: Dass die, die dann an mich denken, sagen: „Überwiegend war er ein anständiger Kerl!" Denn viel wichtiger, als sich ein Denkmal zu setzen, ist es, im Leben anständige Erinnerungen zu prägen. Die sind zwar nicht mit Denkmälern versehen, aber das ist auch nicht wichtig. Von meinen Kindern wünsche ich mir, dass sie – wenn sie erwachsen sind – sagen: "Mein Vater ist ein guter Freund von mir." Und dass sie ein paar Sachen von mir lernen: Dass sie ehrlich und geradlinig durchs Leben gehen und nicht nach unten treten.
Maxeiner: Ich habe kürzlich eine wunderbare Konzertkritik in der Berliner Morgenpost gelesen, von Julia Friese, die Sie als den „Rainer Maria Rilke" des deutschen Schlagers bezeichnet. In einem Gedicht von Rilke heißt es: „Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge zieh’n. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn." Können Sie mit diesen Zeilen etwas anfangen und wie würden Sie das für sich interpetieren?
Kaiser: Versuchen, die Dinge zu erreichen, die man erreichen will, obwohl man genau weiß, dass man all das, was man im Leben erreichen möchte, wahrscheinlich nie zu Ende bringen wird. Ich bin – wie Sie auch – ein großer Freund von Rainer Maria Rilke und finde den Vergleich schön.
Maxeiner: Noch eine letzte Frage, zum Thema Organspende; ein Thema, das Ihnen ja auch sehr am Herzen liegt. Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, dass jeder einen Organspendeausweis bei sich trägt, auf dem er „Ja" oder „Nein" angekreuzt hat?
Kaiser: Für mich sind Sie die erste Gesprächspartnerin, die das so sieht wie ich. Denn die meisten Menschen gehen da völlig falsch heran. Ich will ja gar nicht, dass jeder „Ja" sagt, sondern ich will nur, dass jeder überhaupt etwas sagt. Ich habe in all meinen Interviews immer betont, dass ich als Botschafter der DSO nicht erwarte, dass alle laut brüllen: „Hurra, ich will!" – nur, dass sie einfach sagen, was sie wollen: „Ja" oder „Nein".
Und das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Jeder von uns muss am Tag mehrfach Entscheidungen treffen, ob er links oder rechts abbiegt, ob er sich diese oder jene Hose kauft, ob er Gemüse, Obst oder vielleicht Fleisch einkauft – dann kann ich doch beantworten, ob ich ein Organspender bin oder nicht!
Diese Frage ist ganz einfach. Viele kommen ja mit dem Argument: Ich bin katholisch, ich darf das nicht. Warum nicht? Beide Päpste haben einen Organspendeausweis. Und es gab mal eine Konferenz in Deutschland mit den katholischen und evangelischen Bischöfen, auf der beschlossen wurde, dass die Entscheidung, Organspender zu sein – bei vollem Bewusstsein getroffen – eine christliche Handlung ist. Letztendlich muss man auch wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst betroffen sein wird und ein Organ benötigt, dreimal so hoch ist wie die Wahrscheinlichkeit, Spender sein zu können.
Die Politik hatte ja mal darüber nachgedacht, das Verfahren einzuführen, das Österreich bereits praktiziert: Nämlich, dass jeder automatisch Spender ist, wenn er nicht Nein gesagt hat. Aber das fand keine Mehrheit.
Maxeiner: Sollte diese Entscheidung nicht jeder ganz individuell und bewusst für sich treffen?
Kaiser: Ja, aber wenn es dann solche Verteilungsskandale bei der Organspende gibt, wie in Giessen und anderen Orten, schreibt die Presse wieder „Spendenskandal" und das Vertrauen der Bevölkerung ist erst einmal dahin.
Maxeiner: Auch der Ethikrat ist sich in der Frage über die Voraussetzungen einer Organspende nicht ganz einig. Die Experten dort diskutieren darüber, ob der Hirntod wirklich der Tod eines Menschen ist, und konnten keine Einigung in dieser Frage erzielen …
Kaiser: Zwei unabhängige Neurologen müssen ja bescheinigen, dass ein Mensch hirntot ist. Aber es gibt eben viele Menschen, die nicht verstehen, was genau es bedeutet, wenn jemand „hirntot" ist. Denn das Herz schlägt ja trotzdem weiter. Und nun muss der Angehörige eine Entscheidung treffen. Fakt ist, dass der hirntote Mensch nicht wieder zurück ins Leben kommt. Sein Herz kann noch drei Jahre schlagen, aber er bleibt dort in seinem Krankenbett liegen.
Eine wichtige Frage, die man dann den Angehörigen stellen muss, ist: "Willst du das?" Und dann kommt noch ein – meines Erachtens – ganz wesentliches Argument dazu: Warum müssen unsere Angehörigen eine Entscheidung treffen, ganz allein, wenn nicht einmal wir selbst zu Lebzeiten diese Entscheidung treffen und nicht sagen, was wir wollen?
Wenn der Angehörige ganz allein dasteht und irgendwann der Arzt ins Zimmer kommt und sagt: „Frau Maier, ihr Mann ist hirntot, wir könnten jetzt seine Organe entnehmen, aber wir bräuchten Ihre Einwilligung – und zwar innerhalb einer Stunde", ist es jedenfalls zu spät. Denn dann ist die Ehefrau bereits vollkommen aufgelöst und soll dann auch noch eine Entscheidung treffen, die ihr Ehepartner zu Lebzeiten nicht getroffen hat, vielleicht auch deshalb nicht, weil er sie nicht treffen wollte.
Wieviel einfacher wäre es gewesen, wenn er festgelegt hätte: „Das möchte ich!" oder „Das möchte ich nicht!", dann würde er seine Ehefrau jetzt nicht in ein – für sie – praktisch unauflösbares Dilemma stürzen. All das zeigt, dass die Entscheidung "Organspende ja oder nein" eine leichte Entscheidung ist. Manchmal frage ich Menschen auch: „Hast du denn schon dein Testament gemacht?", und sie antworten in der Regel: „Ach, was, ich bin doch erst 45!", worauf ich entgegne: „Na und? Das interessiert den Bus nicht, der dich überrollt und auch nicht den Blitzschlag, der dich trifft."
Menschen wollen sich nicht mit dem Tod auseinandersetzen. Weil sie mit ihm keinen Vertrag haben … und weil sie keinen festen Glauben in sich tragen. In den Ländern, in denen Menschen einen festen Glauben haben, ist es für sie einfacher Abschied zu nehmen. Sie haben weniger Angst vor dem Tod als wir. Für uns ist der Tod ein diffuses schwarzes Loch und deshalb sagen wir: „Um Gottes willen, bloß nicht dran denken. Aber die Frage ist doch, wenn nicht heute daran denken, wann dann?
Herr Kaiser, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch!
Mehr über unsere Aktion „Was wirklich zählt im Leben" für mehr Mitmenschlichkeit finden Sie im Internet: http://was-wirklich-zaehlt-im-leben.jimdo.com/ und auf FB: https://www.facebook.com/groups/was.wirklich.zaehlt.im.leben/?ref=bookmarks










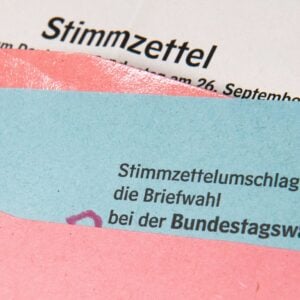

















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion