
Flucht vor dem Kriegsdienst ist keine Option: Ein Soldat zwischen Front und Familie

Gekochter Himbeersaft mit Schweinefett: Diese rosarote „Wunderbrühe“ gab es traditionell immer, wenn sie krank war. Yana Koval kann sich noch an den Geruch erinnern. Fruchtig mit einer tierischen Note. Da beeilte sich jedes Kind, wieder gesund zu werden. Sie schmunzelt.
Heute, weit weg von ihrer Heimat, serviert die junge Ukrainerin warmen Himbeersaft ganz nach ihrem Geschmack – ohne Schweinefett. Es ist ein seltener Anlass: Ihr Stiefvater ist zu Besuch.
Eine Familie, zwei Welten
Für 15 Tage darf Anton Koval seine Familie in der Schweiz besuchen. Der Krieg hat sie auseinandergerissen. Seit rund zwei Jahren kämpft der 45-Jährige an vorderster Front für die Ukraine, während seine Frau und Kinder sich in der fremden Umgebung einzuleben versuchen.
Im Gegensatz zu den meisten geflüchteten Ukrainern spricht Yana fließend Deutsch. Die Sprache hat sie in der Schule gelernt. Auch das Jahr als Au-pair in Deutschland legte den Grundstein dafür, dass sie heute problemlos alle Behördengänge erledigen kann.
Und es gibt viel zu organisieren – für die eigene Familie, aber auch für die anderen ukrainischen Flüchtlinge. Man helfe einander: bei der Wohnungssuche, Jobsuche, Anmeldung von Schulbesuchen und Integrationskursen und beim Beantragen von Sozialhilfe.

Die Familie fand eine Wohnung in Winterthur. (Symbolbild) Foto: SilvanBachmann/iStock
Das große Glück ist auf Dauer zu klein
Die Familie fand mit viel fremder Unterstützung in Winterthur, nahe der deutschen Grenze, eine Wohnung. „Wir waren glücklich“, blickt Yana zurück. Für den Anfang war die 2,5-Zimmerwohnung ausreichend, doch auf Dauer sei sie zu klein.
Yanas Halbbruder (16) ist autistisch und benötigt seinen eigenen Raum. So teilte sie sich anfangs mit ihrer Mutter Alina und der Halbschwester (12) das zweite Zimmer.
Anspruchsvoller wird es bei der Familie zu Tisch. Mit ausladenden Gesten und einfachen Schlagwörtern erzählt die Mutter: Der Sohn isst fast immer nur Spaghetti, die jüngere Tochter wünscht sich dreimal am Tag Fleisch und die älteste Tochter ist Vegetarierin. Sie seufzt.
Yana ist viel älter als ihre Halbgeschwister und lebte in der Ukraine schon länger unabhängig von ihrer Familie. Die anfängliche Wohnsituation in der Schweiz war für sie besonders schwierig. Später fand die Ukrainerin für sich selbst ein Zimmer bei einer Gastfamilie, bei der sie bis heute lebt. Zum Wäschewaschen geht sie weiterhin zu ihrer Mutter. Und so sieht man sie alle paar Wochen mit großen Koffern von einem Haus zum anderen ziehen.
Hilfe für die einen, Ärger für die anderen
Zu Beginn des Ukraine-Krieges engagierten sich viele Schweizer und wollten helfen. Rund die Hälfte der geflüchteten Ukrainer in Winterthur wurden von Gastfamilien aufgenommen, berichtete die Stadt.
Für diese Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft ist Yana sehr dankbar. Sie und ihre Familie wurden mit Kleidung und anderen Notwendigkeiten versorgt. Dies hätte ihr viele Sorgen erspart.
Doch diese Großzügigkeit hätte auch Neid unter anderen Migranten geweckt, erzählte sie. Diese Menschen konnten nicht nachvollziehen, warum die Ukrainer so viel Hilfe bekamen, während Flüchtlinge aus anderen Ländern diese Unterstützung nicht in dem Maße erhielten.
So hätte es an der Schule, an der Yana als Integrationshelferin arbeitete, auch Schlägereien zwischen ukrainischen Kindern und anderen Kindern mit Migrationshintergrund gegeben.
Ein Blick zurück für den Schritt nach vorn
Für Yana war das erste Jahr nach Kriegsausbruch am schwierigsten. „Ich war wie ein Gemüse“, beschreibt sie ihre lähmende Erschöpfung. Die Sorgen um ihre Familie und Freunde, die noch in der Ukraine sind, lasteten auf ihr. Es gab viele schlaflose tränenreiche Nächte.
Aber auch heute ist das Leben nicht viel einfacher. Für ihre Familie ist Yana wie ein Anker. Ihre Halbgeschwister fragten immerzu, wann die Familie wieder zurück „nach Hause“ könne. Sie vermissten ihren Vater, ihre Hauptbezugsperson. Yana versuchte ihnen die Situation zu erklären, aber sie gaben keine Ruhe.
Im August 2023 organisierte sie schließlich eine Reise in die Heimat. Ein zweiwöchiger Besuch. In der Schweiz dürfen ukrainische Flüchtlinge mit dem sogenannten Schutzstatus S pro Quartal 15 Tage in die Ukraine reisen.
Die Familie war glücklich, den Ehemann und Vater wiederzusehen. Gleichzeitig begannen sie zu begreifen, dass der Ort, den sie einst Zuhause nannten, kein Zuhause mehr ist. Die vertrauten Straßen und Häuser sind verwüstet, Freunde und Nachbarn verstreut.
Nach diesem Kurzbesuch hörte das Drängen auf eine Rückkehr auf. Sie hätten verstanden, dass das Leben jetzt hier ist, in der Schweiz, dass Deutsch die Sprache ist, die sie lernen müssen, und die Zukunft ungewiss bleibt.
Doch es gibt Ukrainer, die sich anders entschieden haben.

In diesem Supermarkt in Tschernihiw hat die Familie früher eingekauft. Dieses Foto machte Yana Koval bei ihrem Besuch im August 2023. Foto: Privat
Zwischen Bleiben und Gehen
Bis Ende Juli 2024 haben 66.291 Ukrainer den Schutzstatus S erhalten, schreibt das Staatssekretariat für Migration (SEM). Mit dieser Aufenthaltsbewilligung können die Menschen in der Schweiz leben, arbeiten und Sozialhilfe beziehen, ohne das übliche Asylverfahren durchlaufen zu müssen.
Aus dem gleichen Bericht geht auch hervor, dass für 26.703 Ukrainer der S-Status beendet wurde. Laut SEM handelt es sich bei den meisten Fällen um Ukrainer, die ihre S-Bewilligung freiwillig aufgegeben oder die Schweiz verlassen haben. Darüber berichtet „SWI swissinfo.ch“.
Eine Bewilligung kann aber auch widerrufen werden, wenn die Person sich länger als 15 Tage pro Quartal im Heimat- oder Herkunftsstaat aufhält. Dies betraf nur etwas mehr als hundert Personen.
Die Angst als Freund und Begleiter
Für Yana, ihre Mutter und Halbgeschwister ging es jedenfalls nach zwei Wochen Aufenthalt in der Ukraine wieder zurück in die Schweiz. Anton Koval stellte kurz darauf einen Antrag bei der Armee, seine Familie besuchen zu dürfen. Dieser wurde bewilligt.
Was wäre, wenn Anton nicht mehr zur Armee zurückkehren würde? Was wäre, wenn er jetzt hier in der Schweiz bleiben würde? Er wäre damit nicht der Erste, der vor dem Militärdienst geflohen ist.
Doch für den 45-Jährigen sei dies keine Option, auch wenn er Verständnis dafür habe, wenn andere Ukrainer diese Entscheidung treffen. Das müsse jeder für sich wissen. Er wolle das nicht verurteilen.
Für Anton stand früh fest, dass er für sein Land kämpfen würde. Zu Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 wurde seine Heimatstadt Tschernihiw mehrere Wochen lang eingekesselt. Die Region nördlich von Kiew war eine der ersten, die angegriffen wurde. Er war zu dem Zeitpunkt alleine mit seinen beiden Kindern zu Hause. Yana und ihre Mutter waren im Ausland.
Nachdem er seine beiden Kinder sicher zur Grenze begleitet hatte, meldete er sich im August 2022 freiwillig bei der Armee. Ob er Angst hat? „Natürlich. Wer keine Angst hat, der wird als Erster sterben“, da ist sich Anton sicher. „Die Angst kann im Krieg wie ein Freund sein, ein Begleiter“, fügte er hinzu.
Ein schmaler Pfad zwischen Leben und Tod
Seine erste Konfrontation mit dem Tod erlebte Anton bei seinem ersten Kampfeinsatz im Oktober 2022. Er saß mit drei weiteren Kameraden in einer Falle. Ihnen sei die Munition ausgegangen. Einer von ihnen starb, Anton selbst wurde schwer verletzt. Die anderen beiden konnten fliehen.
Er stand vor einer Entscheidung: Bliebe er in dem Schützengraben, würde er entweder dort sterben oder gefangen genommen werden. Der Gedanke an einer Gefangenschaft war ihm zuwider. So entschied er, zu laufen. Trotz Verletzungen, trotz anhaltender Angriffe.
Dann der Lichtblick: Zwei Einsatzfahrzeuge der ukrainischen Armee näherten sich. Doch ehe sie ihn erreichten, explodierten beide Fahrzeuge – direkt vor seinen Augen. Der Weg war voller Minen. Anton schleppte sich mit letzter Kraft in das nächste Dorf, wo er medizinische Hilfe fand.

Anton Koval kehrt kurz nach seinem Familienbesuch in der Schweiz zurück an die Front. Foto: Privat
Kriege enden, aber Narben bleiben
Solche traumatisierenden Erlebnisse werden auch mit Ende des Krieges nicht einfach aus dem Gedächtnis verschwinden. Dem ist sich Anton bewusst.
Internationale Forscher beschäftigen sich seit Langem mit den psychologischen und sozialen Folgen des Krieges für Veteranen. Nach dem Vietnamkrieg etwa seien viele heimgekehrte US-Soldaten im Alltagsleben nicht mehr zurechtgekommen, schreibt der deutsch-österreichische Historiker Prof. Dr. Rolf Steininger.
Zwischen 500.000 und 800.000 Veteranen litten oder leiden unter einem posttraumatischen Stresssyndrom. Die Anzahl der Suizide unter den Heimkehrern sei höher als die Zahl der im Kampf Gefallenen, so der emeritierte Universitätsprofessor für Zeitgeschichte. In den frühen 1990er-Jahren waren bis zu einem Drittel der etwa 750.000 Obdachlosen in den USA ehemalige Vietnamkriegsveteranen.
Die treibende Kraft hinter dem Leid
Anton Koval kennt diese Statistiken. Er hat viel darüber gehört und gelesen. Sollte er diesen Krieg trotzdem physisch und psychisch überstehen, möchte er sich am Aufbau der Ukraine beteiligen. Er hat vor, besonders die Waisenkinder und Frauen dabei zu unterstützen, ein neues Leben zu beginnen.
Auch Yana spürt den Drang, den ukrainischen Kindern, die „zu viel Leid erfahren haben“, etwas zu geben. Sie hat ein Studium in Psychomotoriktherapie in der Schweiz begonnen und plant, traumatisierte Kinder therapeutisch zu begleiten. Ob in der Schweiz oder in der Ukraine, das bleibe offen. Aber eines stehe für sie fest:
Ich habe so viel Leid gesehen. Aber ich möchte nicht, dass das zu einer Last wird, sondern zu einer Berufung.“






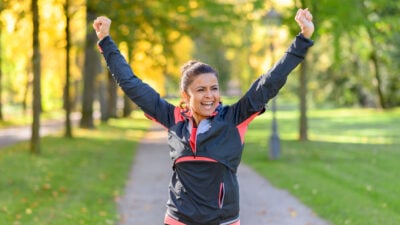

























vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion