
Michael Schwalbé – ehemaliger 1. Geiger der Berliner Philharmoniker gestorben

In der Nacht zum 9. Oktober starb in Berlin die „Konzertmeister-Legende“ Michael Schwalbé im Alter von fast 93 Jahren.
Fast drei Jahrzehnte lang, von 1957 bis 1986, war Michel Schwalbé Erster Konzertmeister der Berliner Philharmoniker: der Mittler zwischen Dirigent und Orchester, eine Art Hohepriester, gefürchtet, beneidet, bewundert, geliebt.
Sein Ton, heißt es, habe der Karajan-Ära den Stempel aufgedrückt, „sinnentrunken“ sei sein Spiel gewesen, „schönheitssüchtig“ „leuchtend“, „brillant“, „verführerisch“. Eine Geige, die singt, die den Gesang niemals abreißen lässt. Das perfekte Legato ist Schwalbés Geheimnis, die rechte Hand, der Bogen, nicht die linke, die man so leicht bewundert, weil es augenfällig ist, dass sich jeder normale Mensch bei solchen verrückt-akrobatischen Verrenkungen die Finger brechen würde.
Geboren wird Michael Schwalbé am 27. Oktober 1919 in Radom/Polen in eine Familie von Geistesmenschen. Beim New Yorker Börsencrash 1929 geht das gesamte Vermögen verloren, man schlägt sich so durch. Der kleine Michel, der damals noch Miecio heißt, weil die Polen mit seinem Vornamen Moses nichts anfangen können, hört eines Tages auf der Straße einen Bettler Geige spielen und wird vom Klang des Instruments ins Mark getroffen. Er studiert bei Moritz Frenkel in Warschau, schließt die dortige Musikhochschule bereits im Alter von 12 Jahren ab und macht mit fast 14 Jahren sein Abitur. Ein Wunderkind. Es folgen Studien in Paris, bei dem Komponisten George Enescu und dem Dirigenten Pierre Monteux.
Sein Nachname übrigens stammt ursprünglich aus Frankreich, Chevalier, und noch etwas ursprünglicher wohl aus Spanien, Cavallero. 1938 gewinnt er in Paris den „Sarasate-Preis“. 1940 flieht Schwalbé, die deutschen Panzer im Rücken, nach Lyon, die Stadt untersteht dem Vichy-Regime. Vier Jahre lang kann er bleiben, ist Konzertmeister des dortigen Symphonieorchesters. 1944 schließlich rettet er sich, in einem Möbelwagen versteckt, in die Schweiz.
Ernest Ansermet engagierte ihn 1944 als Konzertmeister des Orchestre de la Suisse Romande. Michel Schwalbé trat in diesen Jahren solistisch auf und führte von 1946 bis 1948 in Zürich ein eigenes Streichquartett an. Er war Konzertmeister des Schweizerischen Festspielorchesters in Luzern und unterrichtete seit 1948 in der Nachfolge von Joseph Szigeti am Konservatorium in Genf.
Von 1963 bis zu seinem Ruhestand unterrichtete Michel Schwalbé als Professor an der Berliner Hochschule für Musik. Er trat in vielen Ländern als Solist, mit kammermusikalischen Ensembles wie den Philharmonischen Solisten und als Dirigent auf. Nach seiner Pensionierung war er als Jury-Mitglied, Lehrer und Berater für junge Geiger sehr gefragt. Regelmäßig und mit Freude hat Michel Schwalbé die Proben und Konzerte „seines“ Orchesters besucht, sich leidenschaftlich mit seinen philharmonischen Kollegen ausgetauscht und bis zuletzt immer noch Anteil am philharmonischen Leben genommen.
Michael Schwalbé, so stand früh zu lesen, besitze die Leichtigkeit von Jascha Heifetz, die Wärme von Bronislaw Huberman und den Witz von Fritz Kreisler. Nur ist er nicht so berühmt geworden wie diese drei überlebens-großen Geiger der Vergangenheit. Als es zwischen Herbert von Karajan und ihm einmal zu einer Auseinandersetzung kommt, weil der Dirigent seinen Konzertmeister für ein prestigeträchtiges Gastengagement nicht freistellen will, da platzt Schwalbé in aller Form der Kragen. Karajan am anderen Ende der Telefonleitung schweigt, lange, um schließlich einen Satz zu sagen, der Schwalbés ganzes Schicksal und Glück zu besiegeln scheint: „Ich möchte nur wiederholen, dass ich auf Sie nicht verzichten kann.“
Selbstverständlich haben sich die beiden ein Leben lang mit „Herr Schwalbé“ und „Herr von Karajan“ angesprochen. Heutzutage sagen die Philharmoniker einfach „Simon“, wenn sie ihren Chef Simon Rattle meinen, was einerseits der lockeren englischen Art entspricht und für die Generation Schwalbés andererseits absolut unvorstellbar ist.
Schon als kleines Kind hatte Michael Schwalbé die „absolute Präzision“ geliebt. Und sehr schnell sei er gewesen und sehr neugierig, alles habe ihn interessiert, Ameisen, Spinnen, Pflanzen, die Sterne. Yoga hatte er gemacht und sich mit Ramakrishna beschäftigt, den Koran kannte er, das politische Geschehen verfolgte er mindestens so akribisch wie das philharmonische, die Astronomie faszinierte ihn. „Ich danke der Perfektion der Schöpfung auf Knien. Bei mir sind alle Türchen offen, ich bin ohne Religion aufgewachsen.“
Seine Mutter und seine Schwester wurden in Treblinka vergast.
Mit den Frauen hatte er Pech gehabt, zwei Ehen scheiterten, zuletzt lebte er allein.
Herbert von Karajan war der Zwillingsstern seines Lebens. Hunderte von Anekdoten reihen sich aneinander, wie Schwalbé in Karajans zweimotoriger Cessna einmal von Paris nach Hannover fliegt (Landung en piqué!); wie sie vor Dubrovnik auf einem Felsen mitten im Meer sitzen und philosophieren; oder wie Karajan sich bei Axel Springer dafür stark macht, dass sein Konzertmeister eine Stradivari zur Verfügung gestellt bekommt, die „König Maximilian“ von 1709, ein Instrument so empfindsam und so dickschädelig wie sein Spieler. Im Jahr 1999 – längst nach seiner Zeit – wurde diese wunderbare Stradivari als gestohlen gemeldet und ist bisher nicht wieder aufgetaucht.
Michael Schwalbé war mir seit meiner Jugend ein Begriff. Ich habe ihn wiederholt im Konzert erleben können. Unsere letzte persönliche Begegnung war im April 1998 bei einem internationalen Symposium an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm.
Einen Wunsch hatte er für sein nächstes Leben: Er würde dann gerne Michael von und zu Schwalbenburg heißen.



















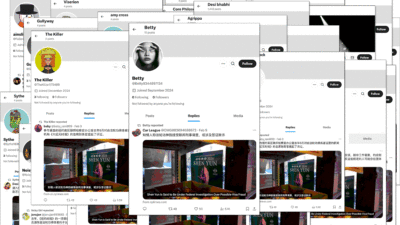








vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion