
Kommunizieren mit Stift und Papier: Sinnlich, persönlich und tief erfüllend

Wenn ich Leuten erzähle, dass meine Freunde und ich Briefwechsel pflegen, bekomme ich oft ein und dieselbe Reaktion. Sie bezeichnen es als wunderbar kuriosen Zeitvertreib. So, als würden wir diese Art der Korrespondenz nur wegen unserer Vorliebe für hübsches Pergament und Federkiele aufrechterhalten.
Sicher verwende ich lieber ansprechendes Briefpapier und Wachssiegel. Aber wenn es sein muss, kann ich auch darauf verzichten. Das Medium des Briefeschreibens selbst öffnet einen Kommunikationskanal mit dem Gegenüber, den digitale Nachrichten nicht nachbilden können.
Der kanadische Kommunikationstheoretiker Marshall Mcluhan war berühmt für seinen Ausspruch: „Das Medium ist die Botschaft.“ Wie etwas gesagt wird, kommuniziert genauso viel – wenn nicht sogar mehr – wie das, was gesagt wird. Wir betrachten die verschiedenen Kommunikationsmittel wie Briefe, E-Mails und Textnachrichten oft als austauschbar. Wir denken, sie würden dasselbe Ziel erreichen, lediglich mit unterschiedlicher Effizienz.
Die Kommunikation scheint eine lineare Entwicklung vom Brief zum Telegramm zur E-Mail und schließlich zur SMS zu sein, wobei jeder Schritt bezeichnenderweise dafür stehe, dass wir frühere, überholte Formen jetzt aufgeben könnten.
In Wahrheit zielen diese Mittel nicht auf das Gleiche ab. Niemand schreibt einen Brief wie eine SMS und obwohl eine E-Mail einem Brief ähnlicher sein mag, übermittelt selbst sie nicht die gleiche Botschaft. Faktisch verwendet jemand Worte in einem Brief ganz anders, als er oder sie es in einem gewöhnlichen Gespräch tun würde.
Beim Briefeschreiben die Fülle der Sprache erhalten
Der Akt des Schreibens fördert eine gewisse Vertraulichkeit. Es erfordert die Entwicklung und den Ausdruck von Gedanken, die in Gesprächen oft unnatürlich erscheinen. Dabei bietet das Schreiben diesen Gedanken, die in Einsamkeit entstehen und einer nachträglichen Prüfung unterzogen werden, eine einzigartige Bühne.
Die bedauernswerte Tatsache ist, dass wir meinen, die Hingabe und Zielstrebigkeit, die es erfordert einen Brief zu schreiben, heute nicht mehr aufbringen zu können. SMS scheinen unserer verkürzten Aufmerksamkeitsspanne viel besser zu entsprechen und ermöglichen es uns, die Verzögerung des Glücksmoments, der zwangsläufig bei einem Brief entsteht, zu vermeiden.
Es ist leicht, angesichts des Zustands der heutigen Sprache zu verzweifeln, und es ist leicht zu erkennen, dass das „Was“ dessen, was wir sagen, schnell abnimmt. Studien haben gezeigt, dass der Wortschatz des durchschnittlichen Amerikaners seit den 1970er-Jahren zurückgeht und der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) konstatiert, dass die Vielfalt der Wörter und die Flexibilität im Wortschatz bei den Kindern sinkt. Damit einher geht der Verfall der Art und Weise des Kommunizierten, also wie Dinge gesagt werden.
Briefe schreiben, sosehr es auch eine verlorene Kunst sein mag, ist ein Mittel gegen den Niedergang der Kommunikation in der Moderne.
Ohne konkrete Briefe erscheint ein solcher Diskurs ziemlich abstrakt. Bei meiner Auswahl an Briefen, welche die besondere und bleibende Schönheit dieser Kommunikationsform widerspiegeln, bin ich dabei ganz voreingenommen.
Freundschaften unter Erwachsenen
Die in dem Buch „84 Charing Cross Road“ enthaltenen Briefe, die sich über 20 Jahre erstrecken, offenbaren die aufkeimende Freundschaft zwischen Helene Hanff und Frank Doel. Ihre Freundschaft lebte und blühte ausschließlich auf dem Papier. Ihre Korrespondenz begann mit Helenes erstem Brief an die englische Buchhandlung Marks & Co., in dem sie bestimmte Buchexemplare anforderte, die ihr in den Staaten nicht zur Verfügung standen.
Die Seiten, die zwischen dem englischen Buchhändler und der amerikanischen Schriftstellerin hin- und hergeschickt wurden, sind gespickt mit funkelndem Humor und einer Großzügigkeit, die Ozeane und Kulturen überspannte.
Was den Briefwechsel so bemerkenswert und herzergreifend macht, ist, genau die Momente mitzuerleben, in denen sich aus einer beruflichen Bekanntschaft eine Freundschaft herauskristallisiert. Und das, obwohl man als Leser zeitlich und räumlich so weit von beiden Beteiligten entfernt ist. Ich hätte nie gedacht, dass eine Zeile wie diese so berührend sein könnte: „Liebe Helene (du siehst, die Unterlagen interessieren mich nicht mehr)“.
Einer meiner persönlichen Lieblingsbriefe stammt von Helene aus dem Jahr 1952 und lautet: „Also wird Elizabeth den Thron ohne mich besteigen müssen und für mich werden es in den nächsten Jahren allein Zähne sein, die ich gekrönt sehe.“

Porträts von Elizabeth Barrett Browning und Robert Browning, 1853, von Thomas Buchanan Read. Foto: Public Domain
Der Dichter Robert Browning und die Dichterin Elizabeth Barrett Browning führten vor ihrer Heirat 19 Monate lang Briefkontakt. Die beiden trafen sich mehrere Monate nach Beginn ihres Briefwechsels persönlich und heirateten eineinhalb Jahre später, nachdem er ihr zum ersten Mal seine Bewunderung für ihre Gedichte kundgetan hatte: „Ich liebe Ihre Verse von ganzem Herzen, liebe Miss Barrett, und dies ist kein unbedachtes Kompliment, das ich schreiben möchte, wie auch immer, keine schnelle, selbstverständliche Würdigung Ihres Genies und somit ein anmutiges und natürliches Ende der Angelegenheit.“
Anregung für die Nachkommenden
Im Jahr 1903 schrieb ein junger Dichter an Rainer Maria Rilke und bat ihn um Ratschläge zum Verfassen von Gedichten. Die Briefe, die Franz Xaver Kappus später erhielt, enthalten jedoch nicht nur Ratschläge zum Dichten, sondern auch Empfehlungen für ein gutes Leben.
In einem Brief von 1904 schrieb Rilke: „Auch zu lieben ist gut: Denn Liebe ist schwer. Liebhaben von Mensch zu Mensch: Das ist vielleicht das Schwerste, was uns aufgegeben ist, das Äußerste, die letzte Probe und Prüfung, die Arbeit, für die alle andere Arbeit nur Vorbereitung ist.“
In seinen Briefen drängt er den jungen Dichter, Einsamkeit und Kummer nicht zu fürchten, da er nicht wüsste, welche Wirkung sie auf seine Seele hätten und ihn als Individuum formen würden.
In einem Brief von 1903 schrieb er: „Sie sind so jung, so vor allem Anfang, und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst liebzuhaben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein.“ (Worpswede, 1903)
Das Selbst entfalten
Beim Briefeschreiben kommt es in vielen Fällen auf die sprachliche Intention an. Wie die australische Schriftstellerin und Musikerin Edwina Preston so treffend bemerkte, lassen Briefe die reale Welt herein, indem sie Unterbrechungen zulassen.
„Es waren vorläufige, in Echtzeit zusammengeflickte Berichte über das Leben, wie wir es erlebten, wie es geschah, an Ort und Stelle. Eine Entfaltung des Selbst in Echtzeit“, sagt sie.

„Junge Frau schreibt einen Brief“, 1903, von Albrecht Anker. Foto: Public Domain
Sogar die scheinbar unbedeutenden Momente, die im Hintergrund während des Schreibens in unser Bewusstsein sickern, finden oft ihren Weg auf das Blatt Papier. Da das Schreiben selbst Zeit und Überlegung erfordert, erlaubt es dem „Stoff, aus dem das Leben ist“, präsent zu sein.
Obwohl Briefe als Chronik unseres Lebens dienen können, ist ein Brief nicht nur eine langweilige Aufzählung der Ereignisse eines Tages, wie man sie in einem Tagebuch schreiben würde. Der Bericht berücksichtigt seinen späteren Adressaten und ist „ein fortlaufendes, unvollendetes Gespräch – ein Brief ruft eine Beziehung hervor, also muss er auf den Leser eingehen, was bei einem Tagebuch nicht der Fall sein muss“, führt Preston aus. Es berücksichtige daher die Freude, die dem Empfänger bereitet werden soll.
Beim Schreiben eines Briefes müssen viele Entscheidungen getroffen werden. All das kommuniziert sich über die Worte hinaus. Die Entscheidungen des Absenders hinsichtlich der Papiersorte, der Verwendung von Tinte oder Bleistift, der Verwendung von wilder Krakelei oder sorgfältiger Handschrift und der Umgang mit Fehlern oder Umformulierungen ergeben eine umfassende Botschaft. In jeder dieser Entscheidungen sowie in der Entscheidung, welche Ereignisse eine solch dauerhafte Niederschrift verdienen, lesen wir den Charakter unseres Briefpartners.
Da all diese Entscheidungen im Hinblick auf die andere Person getroffen werden, ist es auch ein greifbarer Ausdruck der Wertschätzung, die eine Person für eine andere empfindet. Es ist etwas, das geschätzt und erwidert werden sollte. All dies ist bei digitaler Kommunikation nicht der Fall.
Frau Preston merkt an, dass die verzögerte Reaktion beim Briefeschreiben in der Natur der Sache liegt. Diese würde hingegen bei E-Mails und Textnachrichten, die der sofortigen, ja sogar ununterbrochenen Kommunikation dienen, negativ ausgelegt werden. Vielleicht mit Ausnahme einer Teenagerin, die darauf wartet, dass ihr Schwarm ihr antwortet, macht das Warten auf eine Textnachricht den Erhalt kaum jemals schöner, während die Vorfreude auf einen Brief die Freude über den Erhalt steigern kann.
Am Tag der Hochzeit eines guten Freundes ließ der Bräutigam der Braut einen Brief überbringen, während sie auf den Beginn der Trauung wartete. Er hatte ihn kurz nach ihrem ersten Rendezvous vor einigen Jahren geschrieben. Darin brachte er seine Sorge hinsichtlich ihrer Gedanken über ihn zum Ausdruck. Die Angst Philips hatte sich einfach in Vertrauen und Hoffnung gewandelt und fand mit dem Tag, an dem seine Braut den Brief lesen würde, seine Erfüllung.
Jetzt war der perfekte Zeitpunkt gekommen, es zu sagen. Die Worte hatten lange auf sich warten lassen, aber das Warten hat sich gelohnt und mit dem Lauf der Jahre wurden sie nur noch schöner.
Über den Autor:
Marlena Figge erhielt 2021 ihren Master of Arts in italienischer Literatur am Middlebury College und schloss 2020 ihr Studium an der University of Dallas mit einem Bachelor of Arts in Italienisch und Englisch ab. Derzeit hat sie ein Lehrstipendium und unterrichtet Englisch an einer High School in Italien.













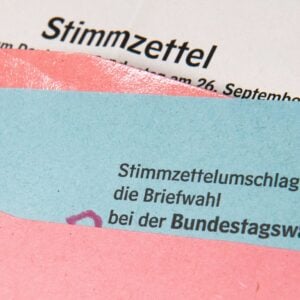

















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion