
Deutschlands Kulturbauten haben es schwer – Ein Stararchitekt sieht System dahinter

Das Projekt wuchs Richard Wagner über den Kopf. Zwischen Grundsteinlegung und Eröffnung seines Festspielhauses in Bayreuth durchlitt der Komponist vier quälende Jahre. Das Geld ging aus, Gönner sprangen ab. 1878 konnte er es endlich einweihen. „Ich habe nicht geglaubt, dass sie es zustande bringen würden – sagte mir der Kaiser.“ So erinnerte sich Wagner (1813-1883) später.
Kostenexplosionen, Fehlplanungen, geplatzte Termine – Kulturbauten in Deutschland, das zeigt der Fall Wagner, hatten es selten leicht. Auch an jüngeren Beispielen mangelt es nicht. Von der Elbphilharmonie bis zum Berliner Stadtschloss: Bei den mit Steuergeldern finanzierten Vorhaben muss im besten Fall nachjustiert werden, im schlimmsten sind jahrelange Verzögerungen und Skandale mit im Spiel.
Die jetzt verschobene Eröffnung des Humboldt Forums in Berlin ist dabei vergleichsweise glimpflich. Die für 600 Millionen Euro errichtete Schlosskopie ist im Kostenrahmen und wenn alles gut geht, können die Probleme bei Klimaanlage und Brandschutz relativ schnell behoben werden. Die Verantwortlichen im Innen- und Bauministerium rechnen mit einer Eröffnung im kommenden Jahr.
Der Architekt Stephan Braunfels sieht deswegen Parallelen zu dem sich seit sieben Jahren hinschleppenden Bau des Hauptstadtflughafens BER als überzogen. „Im Vergleich zu anderen öffentlichen Bauten läuft es beim Humboldt Forum erstaunlich gut“, sagt Braunfels, der unter anderem zwei Bundestagsbauten in Berlin und die Pinakothek der Moderne in München entwarf.
Dass es oft bei der Haustechnik hapert, ist für den Architekten kein Zufall. Einzelne Gewerke wie Lüftung, Heizung, Sanitär und Brandschutz würden oft ohne abgeschlossene Gesamtplanung vergeben. Weil die öffentliche Hand ihre Aufträge aber an den günstigsten Anbieter vergeben müsse, leide bei der Planung die Qualität. „Das beste Planungsbüro ist oft nicht das billigste.“ Beim Zusammenspiel der technischen Systeme klaffe dann eine „Riesenlücke“, „Katastrophen“ wie bei der Kölner Oper seien die Folge.
Kölner warten noch immer auf ihre Oper
In der Dommetropole werden seit 2012 Oper und Schauspielhaus saniert. Die Wiedereröffnung war für November 2015 vorgesehen. Weniger als vier Monate vorher wurde sie abgesagt. Aus Gesamtkosten von 250 Millionen Euro sind bisher 460 Millionen Euro geworden. Grund seien eklatante Fehlleistungen bei der Planung und der Bauleitung der technischen Ausrüstung, sagte ein Betriebsleiter. Die Kölner warten noch immer, der Kunstbetrieb geht in Ausweichquartieren weiter.
Als Paradebeispiel für ausufernde Kosten dürfte der Bau der Elbphilharmonie gelten. Die anfangs mit 77 Millionen Euro geschätzten Kosten für den „Elphi“-Bau auf dem Kaispeicher A im Hamburger Hafen stiegen um mehr als das Elffache auf knapp 900 Millionen Euro. Unter einem Ansatz von 500 Millionen Euro hätte man erst gar nicht anfangen sollen, sagt Architekt Braunfels.
Salamitaktik bei der Berliner Staatsoper
Die zu niedrigen Berechnungen haben auch viel mit Politik zu tun, wie es etwa bei der Berliner Staatsoper deutlich wurde. Statt 239 Millionen Euro kostete der Umbau mehr als 400 Millionen, sieben Jahre zog sich die Renovierung hin. Ein Untersuchungsausschuss versuchte Licht ins Dunkel zu bringen.
Das Fazit: Pleiten, Pech und Pannen vermengten sich mit den für Kritiker überzogenen Wünschen der Hausherren. Für teures Geld musste in den Berliner Schlammboden eine unterirdische Verbindung zwischen Opernhaus und Verwaltungs- und Proberäumen gebuddelt werden. Die Saaldecke wurde fünf Meter gehoben, damit die Musik eine halbe Sekunde länger nachhallen kann.
Die Kosten, das wurde im Untersuchungsausschuss deutlich, wurden zunächst kleingerechnet, um das Projekt durch die politischen Instanzen zu bringen. Nach der Salamitaktik wurden sie dann schrittweise erhöht. Der Bund hatte seine finanzielle Beteiligung gedeckelt, Berlin blieb auf den Mehrkosten sitzen.
Die Staatsoper Unter den Linden glänzt nun seit zwei fast Jahren im neuen Plüsch, die Bühnentechnik ist vom Feinsten. Daniel Barenboims Haus ist das Schicksal von Richard Wagners Festspielarena erspart geblieben.
Wagner musste sich von König Ludwig II. von Bayern einen Kredit erbetteln, um das Theater auf dem Grünen Hügel zu vollenden. Das Geld zahlte die Familie bis 1906 zurück. Die ersten Festspiele mit dem „Ring des Nibelungen“ wurden allerdings ein finanzielles Desaster. Danach stand das Festspielhaus sechs Jahre leer. (dpa)

Die frisch renovierte Staatsoper in Berlin, deren Instandsetzung deutlich teurer wurde als geplant. Foto: Paul Zinken

Die Elbphilharmonie in Hamburg – lange wurde um das Projekt gerungen. Foto: Daniel Bockwoldt



















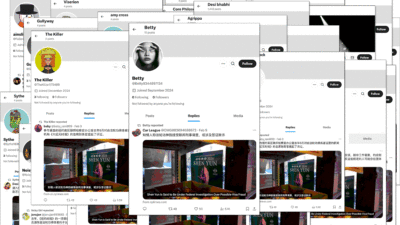








vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion