
NZZ korrigiert Falschinformation zum Epoch-Times-Artikel

In einem Artikel vom 27. Mai 2024 greift die Schweizer Zeitung NZZ das internationale Medienhaus Epoch Times an. Dabei versuchen die Autoren in erster Linie, die Epoch Times in eine unseriöse Ecke zu stellen, indem sie sich intensiv mit der Verbindung zu Falun Gong auseinandersetzen.
Es ist kein Geheimnis, dass die Gründer der Epoch Times Falun-Gong-Praktizierende sind. Im Gegenteil, wir kommunizieren diese besondere Gründungsgeschichte offen. Sie bildet den Grundstein und sozusagen die DNA unseres Selbstverständnisses:
Wegen der brutalen Verfolgung der buddhistischen Meditationsbewegung in seiner Heimat wollte sich John Tang, unser Gründer, im amerikanischen Exil für die Bekanntmachung der Wahrheit über die schweren Menschenrechtsverletzungen in China einsetzen.
Für ihre Berichte über Menschenrechtsverletzungen wurde die Epoch Times in den USA mehrfach mit Preisen für professionellen Journalismus ausgezeichnet. Kürzlich hat ein amerikanischer Kongressabgeordneter die Leistung der Epoch Times in die Kongressakten aufgenommen.
Für die unabhängige Berichterstattung haben Mitarbeiter der Epoch Times einen hohen Preis bezahlt. In China wurden einige unserer Reporter zu zehn Jahren Haft verurteilt.
NZZ korrigiert Falschinformation
Die Epoch Times ist ein Unternehmen, das von Falun-Gong-Praktizierenden gegründet wurde. Aber das Medienhaus ist weder ein Sprachrohr von Falun Gong, noch gehört es zu Falun Gong. Genauso wie die NZZ Mitarbeiter hat, die an das Christentum glauben, aber das Unternehmen nicht einer Kirche angehört. Heute arbeiten für die Epoch Times Menschen mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen.
In ihrem Artikel behauptet die NZZ durchgehend, die Meditationsbewegung Falun Gong betreibe das Medienhaus Epoch Times, indem sie bewusst die falsche Behauptung aufstellt, der Gründer von Falun Gong sei der Gründer der Epoch Times. Das Ziel ist, durch die Verleumdung von Falun Gong die Epoch Times in ein schlechtes Licht zu rücken. Leider.
Es ist allgemein bekannt und auch auf der Website der Epoch Times veröffentlicht, dass John Tang der Gründer der Epoch Times ist. Diese einfache Tatsache könnte mit einer Recherche von nur einer Minute geklärt werden. Dennoch ist der NZZ ein so offensichtlicher Fehler unterlaufen. Gibt es etwa einen anderen Grund als den, dass der Artikel von vornherein eine bestimmte Agenda verfolgt? Die KP Chinas dürfte sich jedenfalls über die Wiedergabe ihrer Darstellung freuen.
Die NZZ hat die Angaben über den Gründer nur widerwillig und auf unseren entsprechenden Hinweis hin korrigiert.
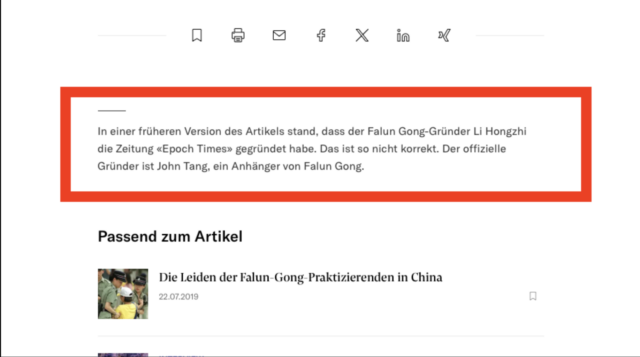
NZZ korrigiert Falschinformation. Foto: Screenshot: nzz.ch
Gleichzeitig wurde diese Falschmeldung jedoch von der NZZ relativiert und heruntergespielt. Auf Anfrage der Epoch Times antwortet die NZZ, es handle sich um eine „zulässige journalistische Ungenauigkeit“ und sogar um eine legitime Interpretation der Autorinnen. Wer aber in Wirklichkeit der Gründer der Epoch Times ist, lässt sich nicht interpretieren. Zuletzt entschuldigt sich die NZZ trotz dieser Selbstrechtfertigung: „Sollte ein falscher Eindruck entstanden sein, bedauern wir dies.“
Aktive Religionsdiskriminierung
Um ihre Agenda zu bedienen, lassen die Autoren zwei sorgfältig ausgewählte Experten zu Wort kommen, die Falun Gong genauso negativ darstellen, wie es die Medien der KP Chinas tun.
Die NZZ sieht aber keinen Anlass, Falun-Gong-Praktizierende zu den vehementen Vorwürfen zu befragen. Auch hier wäre es ein Leichtes gewesen, der journalistischen Sorgfaltspflicht „audiatur et altera pars“ nachzukommen, also auch die andere Seite zu hören. Dazu wäre nicht einmal eine simple Presseanfrage nötig gewesen, denn zu all den überholten Vorwürfen haben Falun-Gong-Praktizierende längst im Internet Stellung genommen.
Nach Ansicht eines Mitarbeiters des Falun Dafa Informationszentrums sind die von der NZZ erhobenen Vorwürfe keineswegs neu und zudem einfach zu widerlegen. So zeigt er in einem Video zum Thema „Mischehen“ ein Bild von seiner eigenen Familie und anderer Praktizierenden, die alle „Mischehen“ eingegangen sind und gemeinsame Kinder haben. Dies kommt unter Falun-Gong-Praktizierenden sehr oft vor.

Ein Video des Falun Dafa Informationszentrums zu Falschdarstellungen über Falun Gong zeigt das Bild eines Falun-Gong-Praktizierenden mit seiner Frau und seinen Kindern sowie weitere Beispiele von „Mischehen“. Foto: Screenshot: Faluninfo.net
Journalistische Recherche und ausgewogene Berichterstattung wären hier ein Leichtes gewesen. Aber das passt anscheinend nicht in das beabsichtigte NZZ-Narrativ.
Einseitig negative Konnotation
Passend zum Narrativ verwendet die NZZ in der Überschrift und durchgängig im Text den Begriff „Sekte“ zur Klassifizierung von Falun Gong. Diese Bezeichnung hat ihren Ursprung in der Propaganda der Kommunistischen Partei Chinas, um die brutale Verfolgung zu legitimieren. Im Sprachgebrauch ist dieser Begriff eindeutig negativ besetzt. Westliche Regierungen wie die deutsche Bundesregierung oder die US-Regierung verwenden dagegen den neutralen und sachlich zutreffenden Begriff „spirituelle Meditationsbewegung“.
Auf unsere Nachfrage hin bestätigt die NZZ, dass der Begriff negativ besetzt sei. Sie fügt aber gleichzeitig rechtfertigend hinzu, dass die Verwendung als Bezeichnung für Falun Gong der Meinungsfreiheit unterliege. Diese Meinungsfreiheit wird jedoch in Anspruch genommen, um die Kommunistische Partei Chinas zu verteidigen, die Tausende von Falun Gong-Praktizierenden getötet und Millionen inhaftiert hat. Zahlreiche von ihnen sind sogar Opfer von Organraub geworden.
Der NZZ-Artikel gibt an mehreren Stellen die Meinung der Autorinnen wieder. Während sich die NZZ-Redaktion jedoch auf die Meinungsfreiheit beruft, ist sie der Auffassung, dass dieser Artikel nicht als Meinungsartikel gekennzeichnet werden muss, und hat ihn als Nachricht unter der Rubrik Technologie veröffentlicht. Es ist bedauerlich, dass unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit journalistische Sorgfaltspflichten und Standards missachtet werden.
Ausgebildet im chinesischen Propagandaapparat
Es fällt auf, dass in diesem NZZ-Artikel die gleichen Punkte angesprochen werden, das gleiche fabrizierte Material und gleichen Begriffe zur Verleumdung von Falun Gong verwendet werden, die man aus der chinesischen Presse kennt.
Bei unserer Recherche ist uns aufgefallen, dass eine der Autorinnen des NZZ-Artikels Globale Medien und Kommunikation an einer chinesischen Universität in Shanghai studiert hat. Nach Abschluss ihres Studiums hat sie nach eigenen Angaben für die chinesischen Staatsmedien „Global Times“ und „CGTN“ gearbeitet, die zum Sprachrohr der KP Chinas gehören. Die Autorin erfüllte damit die Anforderungen der kommunistischen Führung Chinas und förderte beispielsweise das Bild von Tibet, welches Peking nach außen vermitteln möchte.
Laut den Chinaexperten Mareike Ohlberg und Clive Hamilton stehen beide Medien „unter der Führung der Zentralen Propagandaabteilung” der Kommunistischen Partei Chinas. Sie wurden gegründet, um „insbesondere in der Zusammenarbeit mit Ausländern ihr ‚kommerzielles Gesicht zu zeigen‘“.
Darüber hinaus hat die Autorin mehrfach mit Konfuzius-Instituten in Deutschland zusammengearbeitet. Diese Institute werden direkt von der KP Chinas finanziert und das Bundesamt für Verfassungsschutz in Deutschland stuft sie als Instrument zur politischen Einflussnahme des chinesischen Regimes ein. In mehreren Ländern, darunter beispielsweise Schweiz, Kanada und Schweden, haben zahlreiche Universitäten die Zusammenarbeit mit den Instituten wegen dieser Instrumentalisierung beendet.
In einem Antwortschreiben an die Epoch Times schreibt die NZZ: „[Die Erstautorin des Artikels] bringt ihre journalistische Erfahrung ein, die sie unter anderem auch durch Aufenthalte in China gewonnen hat.“ Doch die NZZ hat „keinerlei Zweifel an ihrer Integrität“.
In dem Artikel der NZZ wird auch Bezug genommen auf ein jüngst veröffentlichtes Video des Formats „Leas Einblick“ auf EpochTV, das Aktivitäten der Agenten der chinesischen Geheimpolizei im Ausland journalistisch fundiert darstellt. Nach Ansicht der NZZ-Autoren sei dies jedoch „skandalisierend“ und würde die KP Chinas „verteufeln“.
Der Autor Alexander Wallasch schreibt auf seinem Portal dazu:
„Der Skandal könnte größer kaum sein. Bei der NZZ schreibt eine bei den führenden Staatsmedien der Kommunistischen Partei Chinas ausgebildete Schweizer Journalistin einen vernichtenden Artikel über eine deutsche Zeitung, die von der chinesischen Führung verfolgt wird. Um den Falun-Gong-Hintergrund der Epoch Times zu diskreditieren, nutzt die NZZ dieselben Verschwörungstheorien, welche die chinesische Führung verwendet hat, um diese Gruppe zu verfolgen, grausam zu quälen, einzukerkern und zehntausende ihrer Anhänger zu ermorden.“
Eines ist sicher: Wenn die NZZ ohne Rücksicht auf das westlich-liberale journalistische Ethos die gleichen Vorwürfe zur Religionsdiskriminierung wie die KP Chinas erhebt und Falun-Gong-Praktizierende nicht anhört, macht sie sich die verleumderische Propaganda der KP Chinas zu eigen. Mit der Behauptung, die Epoch Times würde die KP Chinas verteufeln, verharmlosen die Autoren die weltweit brutale Verfolgung chinesischer Dissidenten. Zuweilen wird manchmal auch im Westen die skurrile Auffassung vertreten, Menschenrechte seien Auslegungssache und von Land zu Land unterschiedlich zu verstehen.







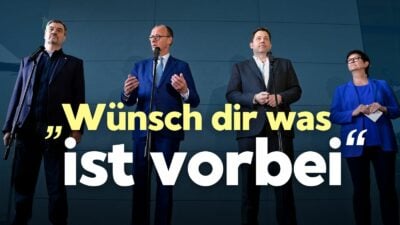
![A100 in Berlin: So geht es nach der Stillegung der Ringbahnbrücke weiter [Pressekonferenz]](https://images-de.epochtimes.de/uploads/2025/03/Thumbnail-Autobahn-GmbH-Update-Berlin-400x225.jpg)



















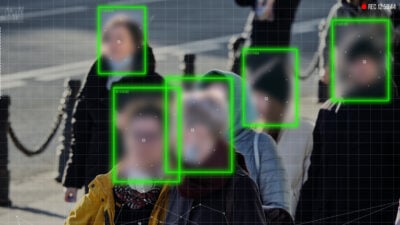



vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion