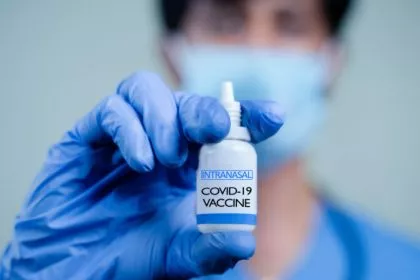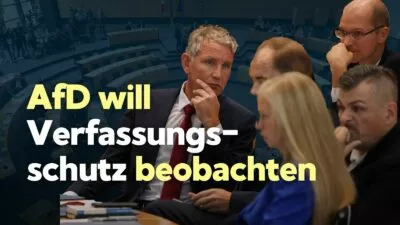Kurze Immunitätsdauer: Aussichten für Impfstoff gegen Coronavirus gering
Bisher ist es noch bei keiner Corona-Viruserkrankung wie SARS, MERS oder der klassischen Erkältung gelungen, einen Impfstoff zuzulassen. Auch ob eine einmalige Infektion vor einer erneuten Ansteckung schützt, ist fraglich.

Die Entwicklung eines Impfstoffes ist eine Herausforderung. (Symbolfoto)
Foto: istock
Zurzeit gibt es weltweit über 78 Projekte, um einen Impfstoff gegen COVID-19 zu finden. Davon befinden sich neun in den klinischen Phasen, werden also zurzeit bereits an gesunden Menschen getestet. Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor.
Während die Hoffnung auf einen geeigneten Impfstoff groß ist, war die Forschung für Impfstoffe gegen Coronaviren in der Vergangenheit jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Bislang fand man gegen keines der für Menschen infektiösen Coronaviren einen Impfstoff. Dies gilt sowohl für Erkrankungen mit schweren Verläufen bei SARS- und MERS-Viren als auch für relativ harmlose wie Erkältungsviren, die zur Coronaviren-Familie gehören.
Das liegt laut Forschern zum Einen an der geringen finanziellen Förderung und dem geringen Forschungsinteresse nach dem plötzlichen Verschwinden von SARS, zum Anderen auch an Hindernissen durch die Coronaviren selbst.
Hindernisse für Immunität
Die spezifische Immunität bedeutet, dass Immunzellen bei erneutem Kontakt mit einem Erreger gezielt gegen diesen vorgehen. Dies funktioniert dann, wenn der Körper ausreichend Antikörper bildet. Vor allem Immunglobulin G (IgG) ist dabei von großer Bedeutung, da es quasi als „Immungedächtnis“ agiert. So ist das Immunsystem in der Lage, einen Erreger wiederzuerkennen und den Körper vor einer Infektion zu schützen. Dies ist eine Strategie, die auch bei Impfungen eingesetzt wird.
Nun zeigte eine kürzlich veröffentlichte, nicht peer-review geprüfte Studie, die Antikörpertests untersuchte, dass die Konzentration von IgG im Blut von ehemaligen Infizierten bereits zwei Monate nach dem Auftreten der ersten COVID-19 Symptome deutlich abnahm. Die Antikörperkonzentration lag aber zu diesem Zeitpunkt noch über der Nachweisgrenze für die verwendeten Antikörpertests der Studie. Diese Ergebnisse könnten auf eine kurze Immunitätsdauer hinweisen.
Interessant war zudem, dass die Studie keinen Zusammenhang zwischen der Schwere einer COVID-19-Erkrankung und der Produktion von Antikörpern fand.
Bei den 40 untersuchten genesenen COVID-19 Patienten gab es zwischen asymptomatisch, milden und schweren Verläufen keinen Trend bei der produzierten Antikörperkonzentraton. Dies weist darauf hin, dass nicht die Schwere der Erkrankung, sondern die individuelle Stärke des Immunsystems die Antikörperbildung bestimmt.
Eine in China durchgeführte Untersuchung an zwei Rhesusaffen zeigte, dass diese bei erneutem Kontakt mit dem neuartigen Virus keine Symptome mehr entwickelten. Die Forscher gingen daher von einer gewissen Immunität aus. Allerdings gibt es immer wieder Berichte darüber, dass sich bereits Genesene erneut infizierten. Untersuchungen in diese Richtung stehen noch aus.
Herausforderungen bei Impfstoffsuche
Es scheint also ein Impfstoff benötigt zu werden, der das Immunsystem besser zur Bildung von IgM-Antikörper bewegen kann als das originale Virus. Dadurch erreichen gewisse Impfstoffstrategien wie Lebendviren in niedrigen Konzentrationen ihre Grenzen.
Impfstoffe für Coronaviren sind eine Herausforderung. Das zeigt auch die Forschung an Coronaviren, die Tiere befallen. Dabei gibt es folgende Coronaviren: IBV, das Geflügel befällt, FIPV bei Katzen, PEDV und SADS, an denen Schweine erkranken.
Trotz internationaler Forschung an Impfstoffen in diesem Bereich ist bislang nur ein einziger offiziell zugelassen: Nobilis® 4-91 gegen IBV bei Hühnern. Dieser schützt jedoch nicht vollkommen gegen die Erkrankung, sondern schwächt nur die Symptome ab.
Eines der Probleme, welche das internationale Forscherteam aus den USA und Italien dabei sieht, ist der antikörper-abhängige Verstärkungsmechanismus (ADE). Durch dieses Phänomen wird die Schwere der Krankheit durch eine Impfung verstärkt.
Immunität durch frühere Erkältung?
Ein Phänomen des neuartigen Virus ist, dass der Verlauf von asymptomatisch, mild, schwer bis hin zu fatal sein kann. Während es dafür noch keine eindeutige Erklärung gibt, werden verschiedene Hypothesen diskutiert.
Virologe Christian Drosten berichtet kürzlich von einer neuen möglichen Erklärung, die seine Kollegen an der Berliner Charité machten. Der Immunologe Andreas Thiel untersuchte dort T-Helferzellen, die nach einer durchgemachten Infektion entstehen.
Professor Thiel und seinem Team war bei Untersuchungen von Proben, die von vor dem offiziellen Ausbruch der Corona-Pandemie stammen, darauf gestoßen, dass 34 Prozent der Patienten reaktive T-Zellen aufwiesen. Diese hätten bestimmte Teile des neuen Coronavirus erkannt, obwohl diese Patienten keinen nachweislichen Kontakt mit SARS-CoV-2 gehabt haben sollen.
Bisher weiß man, dass ungefähr 15 Prozent aller Erkältungsviren zur Familie der Coronaviren gehören. Professor Drosten warnt aber vor einer Überinterpretation der Ergebnisse: „Es ist im Moment nur eine sehr interessante immunologische Beobachtung“, so der Virologe.
{#gesichtsmasken}
Aktuelle Artikel des Autors
02. November 2023
Optimierte Nanopartikel ermöglichen mRNA-Impfungen zum Einatmen
05. Oktober 2023
Traditionelle Ringelblumensalbe – ganz einfach selbst gemacht
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.