
EU-Beschluss: Drohender Handelskrieg mit China wegen E-Auto-Zöllen

Sonderzölle auf E-Autos aus China im Euroraum sind schon längere Zeit ein Thema. Nun sollen sie offenbar tatsächlich kommen: Wie die EU-Kommission am Mittwoch, 12. Juni, mitteilte, soll es ab Juli vorläufige Zölle geben.
Laut Kommission wären dann die Hersteller BYD, Geely und SAIC von diesen Maßnahmen betroffen. BYD wird mit einem Sonderzoll von 17,4 Prozent belegt. Für Geely und SAIC sollen es 38,1 Prozent sein.
Auf alle anderen E-Autos, die in China produziert und in die EU exportiert werden, sollen ab Juli Zölle von 21 Prozent fällig werden. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Hersteller im Vorfeld bei einer Untersuchung durch die EU kooperativ waren. Wer sich nicht kooperativ gezeigt hat, der muss den Höchstsatz von 38,1 Prozent zahlen. Im Moment liegt der Zollsatz bei zehn Prozent.
Staatliche Subventionierung verzerrt den Markt
Seit vergangenen Herbst hatte die EU-Kommission untersucht, ob E-Auto-Hersteller in China von wettbewerbsverzerrenden Subventionen profitieren. Wie die Kommission mitteilte, sei ihr aufgefallen, dass chinesische Elektroautos normaler um etwa 20 Prozent günstiger sind als in der EU hergestellte Autos. „Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt – das verzerrt unseren Markt“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union am 13. September vor dem Europäischen Parlament in Straßburg.
Die Untersuchungen scheinen nun die Vermutungen der Kommission bestätigt zu haben. Die Wertschöpfungskette für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge in China würde von einer unfairen Subventionierung profitieren, so von der Leyen. Herstellern in der EU drohten dadurch Schäden.
Die Entscheidung der EU-Kommission fand auch Gegenstimmung im Euroraum. Vor allem in Deutschland sieht man die Entscheidung aus Brüssel kritisch. So hatte Bundeskanzler Olaf Schulz (SPD) gerade erst Anfang Juni anlässlich des 125-jährigen Opeljubiläums im Stammwerk des Autoherstellers in Rüsselsheim in seiner Rede vor solchen Zöllen gewarnt und bezeichnete diese als „Abschottung der Märkte“. Scholz betonte: „Wir verschließen unsere Märkte nicht vor ausländischen Unternehmen. Denn das wollen wir umgekehrt für unsere Unternehmen ja auch nicht.”
Scholz betonte, dass Protektionismus und unrechtmäßige Zollschranken letztlich die Kosten erhöhen und den Wohlstand für alle mindern würden. Er äußerte keinen Zweifel daran, dass die deutsche Automobilindustrie auch im aktuellen Jahrhundert an der Spitze bleiben könne, solange man auf Fortschritt und Innovation setze. Dafür sei jedoch ein fairer und offener Welthandel unerlässlich. Vor der versammelten Belegschaft von Opel äußerte sich der Bundeskanzler optimistisch und betonte, dass sie in einem fairen Wettbewerb bestehen könnten, auch gegen neue Konkurrenten aus Ländern wie China.
Verkaufspreise für E-Autos könnten steigen
Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel hatte zuletzt berechnet, dass mögliche EU-Zölle auf chinesische Autos spürbar steigende Verkaufspreise für E-Autos zur Folge habe. Nach Bekanntwerden der EU-Entscheidung sprach IfW-Präsident Professor Moritz Schularick zwar davon, dass die EU „Stärke gegen Chinas E-Auto-Subventionen“ zeige. „Die Einführung der Zölle wird spürbare Effekte haben. Aktuelle Berechnungen mit dem KITE-Modell des IfW Kiel zeigen, dass EU-Zölle von dann insgesamt ca. 31 Prozent auf chinesische Elektroautos zu einem Rückgang der Elektroauto-Importe aus China von rund 25 Prozent führen könnten. Das entspricht einem Wert von rund 4 Mrd. US-Dollar“, so Schularick weiter.
Die zu erwartende Erhöhung der Preise für Elektroautos würde allerdings die Klimatransformation verteuern. „Die richtige Balance zwischen fairem Wettbewerb und der Förderung grüner Technologien bleibt eine zentrale Herausforderung“, schlussfolgert der IfW-Präsident.
Vor wirtschaftliche Folgen der EU-Entscheidung für Deutschland warnte am Mittwoch auch der Außenwirtschaftschef der „Deutschen Industrie- und Handelskammer“ (DIHK), Volker Treier, in einer Pressemitteilung. „Die von der EU-Kommission angekündigten Zölle auf E-Autos aus China werden für die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft nicht ohne Folgen bleiben“, so Treier. Zum einen betreffe dieser Schritt auch deutsche Autohersteller in China, zum anderen bahnten sich mit den bereits angekündigten Gegenmaßnahmen Chinas weitere Handelshemmnisse für die deutsche Wirtschaft insgesamt an.
Zwar seien chinesische Wettbewerbsverzerrungen ein besonderes Problem, „das Europa angehen sollte“, machte Treier deutlich. „Die besten Antworten darauf sind aber eigene gute Standortbedingungen und das Streben nach offenen Märkten und Wettbewerb.“
Das könne zum Beispiel durch einen umfassenden Bürokratieabbau und durch neue Handelsabkommen erreicht werden, die den Marktzugang etwa im Indopazifik und Lateinamerika spürbar verbesserten. Treiers Appell: „Weitere Handelskonflikte müssen vermieden werden, ebenso wie eine stärkere Abschottung Europas.“
Grundsätze der Marktwirtschaft verletzt
Die chinesische Regierung hatte in der Vergangenheit schon mehrmals davor gewarnt, die Einfuhrzölle auf E-Autos aus China zu erhöhen. „Letztendlich würde dies den eigenen Interessen der Europäischen Union schaden“, sagte nun ein Sprecher des Außenamtes in Peking. Die EU-Kommission betreibt eine Antisubventionsuntersuchung, die als „Protektionismus“ bezeichnet werden müsse und offenbar eine „Ausrede“ für die Einführung von Schutzzöllen darstelle.
Warnung vor der EU-Zollpolitik gegen China kam auch von den deutschen Autobauern selbst. Fairer und freier Welthandel treibe Innovationen und Wachstum, erklärte Mercedes-Chef Ola Källenius laut der Nachrichtenagentur Reuters. „Was wir nicht gebrauchen können, als Exportnation, sind steigende Handelshindernisse”, so Källenius weiter. Diese sollten im Sinne der Welthandelsorganisation abgebaut werden.
„Ich bin gegen zollbasierte Politik – das kann zu einer Kettenreaktion führen“, warnte auch der Chef des weltweit größten Autozulieferers Bosch, wie das Wirtschafts- und Finanzportal „Dow Jones Newswires“ schreibt, im Vorfeld der erwarteten Zollankündigung der EU im „Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten“ (ICFW). Höhere Importzölle könnten das Wirtschaftswachstum bremsen und die Inflation befeuern, was große Teile der Bevölkerung treffen.
China wichtigster Absatzmarkt für deutsche Autobauer
China ist der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Autobauer, und etwa die Hälfte der aus China importierten Pkw stammt von europäischen Herstellern, die ihre Autos dort produzieren. Mercedes-Benz betonte, dass alle in China gefertigten Fahrzeuge ausschließlich auf dem chinesischen Markt verkauft würden.
Auch für Bosch ist die Volksrepublik ein äußerst wichtiger Markt. Mit 17 Milliarden Euro erzielten die Schwaben dort zuletzt fast ein Fünftel ihres Jahresumsatzes. Der Großteil davon kommt aus der Autozulieferung – die Technik des Weltmarktführers steckt in vielen chinesischen Fahrzeugen. Hartung betonte, dass ihm die chinesischen Hersteller als Kunden genauso lieb seien wie die westlichen. „Ich mag alle Kunden.“
Die Zoll-Entscheidung der EU folgt ähnlichen Maßnahmen wie die der USA, die schon im April Sonderzölle auf Importe von Elektroautos, Halbleitern, Solarzellen, Kränen und weiteren Produkten aus China verhängten. Die USA werfen China ebenfalls vor, den Wettbewerb durch erhebliche staatliche Subventionen zu verzerren. Chinesische Billigprodukte würden gezielt in die USA und nach Europa gelenkt. Peking bestreitet diese Vorwürfe und argumentiert, dass die Branchen durch Innovation vorangetrieben werden und China damit zum Kampf gegen den Klimawandel beitrage.
Laut staatlichen Medien aus China exportierte das Land im Jahr 2023 1,2 Millionen Autos – fast 78 Prozent mehr als im Vorjahr. In Deutschland stieg die Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge aus China im Jahr 2023 nach Daten des Kraftfahrtbundesamtes um 47,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch lagen chinesische Autos mit 33.699 Stück zahlenmäßig weit hinter der Konkurrenz aus anderen Ländern. Der chinesische E-Auto-Gigant BYD erweitert im Moment seine Transportrouten nach Europa und baut eine Fabrik in Ungarn, die ein Tor zum EU-Markt darstellen könnte, ohne den langwierigen Transport über das Meer.
Viele Wirtschaftsvertreter haben die Sorge, dass gegenseitige Strafzölle in einen Handelskrieg münden könnten. Jüngst hat das Handelsministerium in Peking eine Anti-Dumping-Untersuchung gegen Chemikalien aus der EU, den USA, Japan und Taiwan eingeleitet. Wenn Produkte durch hohe Zölle künstlich verteuert werden, lohnt sich der Handel oft nicht mehr. Dies betrifft jedoch nicht nur die Unternehmen, die direkt von den Zöllen betroffen sind. Auch Zulieferer und Logistikunternehmen könnten unter solchen Bedingungen leiden.
















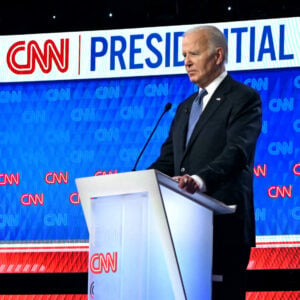















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion