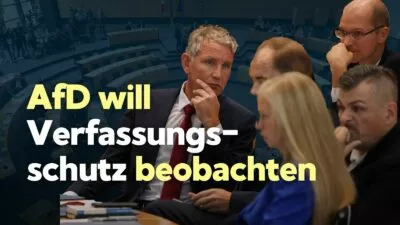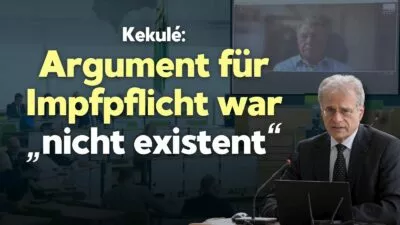EEG belastet Bundeshaushalt: Immer mehr Tage mit negativen Strompreisen
In Deutschland wird stetig mehr Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind erzeugt. Doch fehlende Speicherkapazitäten verhindern ein schnelles Marktgleichgewicht. Daher gibt es häufiger negative Strompreise, und das EEG macht dies für den Staat teuer.

Überlandleitung für Strom bei Bernburg, Sachsen-Anhalt.
Foto: Textbüro Freital
EEG soll helfen, Anbieter erneuerbarer Energien von ungünstigen Marktlagen abzuschirmen
Im Ausland Geld verdienen durch Verbrauch von deutschem Strom
Neuer Rekord an Tagen mit Auftreten negativer Strompreise
Tage mit mehr Angebot als aktueller Marktnachfrage könnten sich mit Solarpaket I noch häufen
Lindner rechnet mit zusätzlich erforderlichen Milliarden für Förderungen nach dem EEG
„Agora Energiewende“ will mit flexiblen Stromtarifen gegensteuern
Aktuelle Artikel des Autors
Kommentare
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
Wenn mir der Staat die Abnahme zu einem Festpreis garantiert produziere ich soviel wie möglich - ob es gebraucht wird ist nicht mehr der Maßstab.
Wenn er mir keinen Festpreis gibt orientiere ich mich an den Bedarf.
Das erstere hat der Osten schon mal vor 40 Jahren probiert - es nannte sich Sozialismus.
Das die Grünen und die SPD das nicht kapieren verstehe ich - liegt wohl an der geringen Berufserfahrung.
Konnte Keiner ahnen, hat auch Niemand gewusst oder gewollt. Immer wieder die Herren Keiner und Niemand.
Wäre es nicht ein sinnvolleres Geschäftsprinzip, solchen "negativen Spotpreis" oder "Phantom-Strom" für die Erzeugung von stromintensivem Wasserstoff zu nutzen? (laut Bundesnetzagentur im ersten Halbjahr 2022 bereits 5.419 Gigawattstunden!)
Fördert darüber hinaus die Euphorie für den Ausbau von regenerativen Energien und damit die Verdrängung von Wärmekraftwerken nicht das Blackout-Risiko? Nur Wärmekraftwerke (Kohle, Atom) stabilisieren heute mit den gewaltigen Schwungmassen ihrer Turbinen und Generatoren die Stromnetze.
Nur zur Sache selbst: Der wirkliche Speicher ist die Kohle, im Winter nutzt die Schwungmasse wenig. Im übrigen wäre heute auch Gleichstrom eine Lösung (siehe HGÜ). Also bei aller berechtigter Kritik, man sollte auch nicht übertreiben: Die Aussage bezieht sich auf die Stabilität des Wechselstromnetzes. Im Hinblick auf Dunkelflauten ist dies jedoch unbedeutend, das Licht flackert etwas länger bis es ausgeht. Die Gasspeicher in der EU sind für ein Drittel das Jahresbedarfs ausgelegt, das ist die Dimension über die wir reden müssen, nicht über Turbinenschwungmassen. Diese DImnsion lässt aber auch den Wasserstoff alt aussehen.Es werden in dieser Diskussion leider soviele Seifenblasen in die Luft geblasen, dass der arme Betrachter das Platzen derselben nicht mehr beobachten kann, weil im die neu produzierten Seifenblasen das Blickfeld verstellen. Es ist höchste Zeit zu den Gesetzen der Physik zurückzukehrn.
Richtiger wäre nicht der Freifahrtschein für die erneuerbare Erzeugung, sondern eine Regelung die festlegt, dass Strom bedarfsgerecht geliefert werden muss und schon wäre der Anreiz geschaffen, Speicher- und Backuplösungen zu implementieren und es würde dann noch etwas deutlich. Erneuerbarer Strom ist richtig teuer aber so will man es offensichtlich haben.
5
Kommentare
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
Wenn mir der Staat die Abnahme zu einem Festpreis garantiert produziere ich soviel wie möglich - ob es gebraucht wird ist nicht mehr der Maßstab.
Wenn er mir keinen Festpreis gibt orientiere ich mich an den Bedarf.
Das erstere hat der Osten schon mal vor 40 Jahren probiert - es nannte sich Sozialismus.
Das die Grünen und die SPD das nicht kapieren verstehe ich - liegt wohl an der geringen Berufserfahrung.
Konnte Keiner ahnen, hat auch Niemand gewusst oder gewollt. Immer wieder die Herren Keiner und Niemand.
Wäre es nicht ein sinnvolleres Geschäftsprinzip, solchen "negativen Spotpreis" oder "Phantom-Strom" für die Erzeugung von stromintensivem Wasserstoff zu nutzen? (laut Bundesnetzagentur im ersten Halbjahr 2022 bereits 5.419 Gigawattstunden!)
Fördert darüber hinaus die Euphorie für den Ausbau von regenerativen Energien und damit die Verdrängung von Wärmekraftwerken nicht das Blackout-Risiko? Nur Wärmekraftwerke (Kohle, Atom) stabilisieren heute mit den gewaltigen Schwungmassen ihrer Turbinen und Generatoren die Stromnetze.
Nur zur Sache selbst: Der wirkliche Speicher ist die Kohle, im Winter nutzt die Schwungmasse wenig. Im übrigen wäre heute auch Gleichstrom eine Lösung (siehe HGÜ). Also bei aller berechtigter Kritik, man sollte auch nicht übertreiben: Die Aussage bezieht sich auf die Stabilität des Wechselstromnetzes. Im Hinblick auf Dunkelflauten ist dies jedoch unbedeutend, das Licht flackert etwas länger bis es ausgeht. Die Gasspeicher in der EU sind für ein Drittel das Jahresbedarfs ausgelegt, das ist die Dimension über die wir reden müssen, nicht über Turbinenschwungmassen. Diese DImnsion lässt aber auch den Wasserstoff alt aussehen.Es werden in dieser Diskussion leider soviele Seifenblasen in die Luft geblasen, dass der arme Betrachter das Platzen derselben nicht mehr beobachten kann, weil im die neu produzierten Seifenblasen das Blickfeld verstellen. Es ist höchste Zeit zu den Gesetzen der Physik zurückzukehrn.
Richtiger wäre nicht der Freifahrtschein für die erneuerbare Erzeugung, sondern eine Regelung die festlegt, dass Strom bedarfsgerecht geliefert werden muss und schon wäre der Anreiz geschaffen, Speicher- und Backuplösungen zu implementieren und es würde dann noch etwas deutlich. Erneuerbarer Strom ist richtig teuer aber so will man es offensichtlich haben.