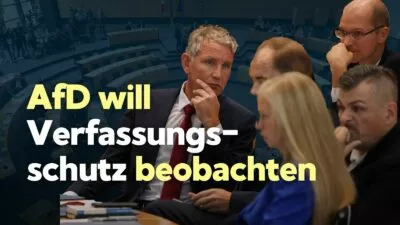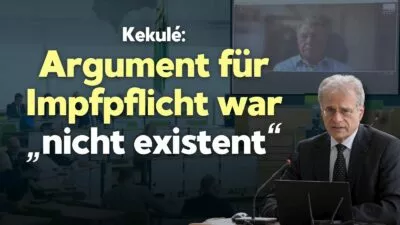Meinung
Afrika wehrt sich: Chinas „Neue Seidenstraße“ gefährdet Souveränität | ET im Fokus
Die „Schuldenfallen-Diplomatie“ Chinas in Afrika gerät weltweit immer mehr in Kritik. Sambia läuft Gefahr, seine Souveränität an China zu verlieren, da China nationale Vermögenswerte beschlagnahmen wird, sobald die Regierung mit ihren Krediten in Verzug gerät.

Frankreich, die USA und das Vereinigte Königreich wurden kritisiert, weil sie Afrika während der Kolonialzeit ausgebeutet haben.
Heute wird diese Rolle dem chinesischen Regime zugeschrieben.
Doch die afrikanischen Länder sind immer weniger damit einverstanden, wie die Pekinger Führung mit ihnen umgeht. Die Konflikte nehmen zu.
Die „Neue Seidenstraße“
Zwischen 2000 und 2017 hat Peking nach einem Bericht des „Brookings Institution“ in Washington Finanzmittel in Höhe von über 140 Milliarden Dollar an afrikanische Länder geliehen. Der Großteil dieser Kredite floss in einige wenige ressourcenreiche Länder, so die staatliche Institution aus Nordamerika.
Nach Sektoren betrachtet konzentrierte sich die Kreditvergabe auf die wichtigen und strategischen Branchen Transport, Stromnetz und Bergbau.
Durch die Bereitstellung großer Mengen von finanziellen Mitteln bestimmt Peking das zukünftige Schicksal des Kontinents. Afrika ist einer der zentralen Punkte des chinesischen Projekts „Neue Seidenstraße“ („One Belt, One Road“).
Um das Ausmaß dieses Projektes verstehen zu können, schauen wir uns dazu eine Karte an.
Im Jahr 2013 stellte die KP Chinas offiziell den Plan für ihre neuen Wirtschaftsambitionen vor: die „Neue Seidenstraße“ und die „Maritime Seidenstraße des 21. Jahrhunderts“, kurz: „One Belt, One Road“ (OBOR).
„One Belt“ bezieht sich auf den Wirtschaftsgürtel der Seidenstraße, der aus drei landgestützten Komponenten besteht: von China über Zentralasien und Russland bis nach Europa und in die Ostsee, von Nordwestchina über Zentralasien und Westasien bis zum Persischen Golf und zum Mittelmeer und von Südwestchina über die Halbinsel Indochina bis zum Indischen Ozean.
„One Road“ bezieht sich auf die „Maritime Seidenstraße des 21. Jahrhunderts“: Die erste Route führt von den Häfen in China zum Südchinesischen Meer, durch die Straße von Malakka und weiter nach Europa über den Indischen Ozean; die zweite führt in den südlichen Pazifik. Eine dritte Route, die „Silk Road on Ice“ oder auch „Polar Silk Road“ (die „Seidenstraße auf Eis“ oder die „Polare Seidenstraße“), wurde später hinzugefügt, um über den Arktischen Ozean nach Europa zu gelangen.
Ziel ist, eine Reihe strategischer Häfen zu bauen und die Kontrolle über den Seeverkehr zu erlangen.
In finanziell soliden Ländern gehen chinesische Unternehmen Beteiligungen oder Joint Ventures ein. Bei finanziell schwächeren Ländern investiert China große Summen vor Ort und ist bemüht, die Rechte als Betreiber der Häfen zu erhalten.
Das führt uns nach Afrika zurück.
Welches Ziel verfolgt China in Afrika?
Sein Ziel ist, den geopolitischen Einfluss Chinas zu erweitern, was den Zugang zu Afrikas Öl, natürlichen Ressourcen und strategischer Lage einschließt. Die KP Chinas scheut dabei keine Mühen.
Im Jahr 2000 wurde das „Forum für die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika“ eingerichtet. Nach und nach hat Peking afrikanische Führer und Regierungen auf seine Seite gezogen, vor allem mit wirtschaftlichen Anreizen.
Damit hat Peking erreicht, dass diese Regierungen und Führer den chinesischen Anweisungen folgen. Seither entwickelte sich Peking zum wichtigsten Wirtschaftspartner Afrikas in den Bereichen Handel, Investitionen, Finanzhilfe und Infrastruktur.
Die „Schuldenfallen-Diplomatie“ Chinas
Vor Kurzem besuchte Yang Jiechi, Chinas Spitzendiplomat, Afrika, um die chinesischen Interessen zu überwachen und die bilateralen Beziehungen zu stärken.
Yang war Außenminister und ist Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas. Im KP-Führungskreis ist er zuständig für Chinas Außenpolitik.
In einem Interview am 22. Dezember kritisierte er diejenigen, die behaupten, China würde Afrika ausnutzen und den Neokolonialismus fördern.
„Einige Menschen, die über die wachsenden Beziehungen zwischen China und Afrika unglücklich sind, haben unbegründete Anschuldigungen erhoben, um unsere Zusammenarbeit zu diffamieren und anzugreifen“, zitiert das chinesische Staatsmedium „Xinhua“ den Parteifunktionär Yang.
„Diejenigen, die versuchen, die traditionelle Freundschaft zwischen China und Afrika zu untergraben, werden nur scheitern.“ – sagte Yang.
Fan Yu schreibt, dass Peking die Entwicklungsländer dazu verführe, teure Kredite zu akzeptieren.
Wenn Politiker oder Staatschefs den Haushalt nicht ausgleichen könnten, um solche Kredite zurückzuzahlen, verhänge das Regime schwere Strafen.
Das beinhalte dann beispielsweise die Übernahme von Vermögenswerten, Infrastruktur wie Häfen, Minen in Bergbaugebieten und anderem.
Laut einem Bericht von McKinsey & Co aus dem Jahr 2017 sind mehr als 10.000 chinesische Firmen in Afrika tätig, wobei Nigeria, Sambia und Tansania die größte Aufmerksamkeit chinesischer Unternehmen auf sich ziehen.
Im Bericht heißt es, dass seit der Jahrtausendwende der Handel zwischen Afrika und China um etwa 20 Prozent pro Jahr wächst.
Und weiter:
„Im Bereich der Infrastruktur ist die Dominanz chinesischer Firmen sogar noch ausgeprägter, und sie beanspruchen fast 50 Prozent des international unter Vertrag genommenen afrikanischen Baumarktes.“
Das Fazit des Berichts macht es deutlich: „Seit 2000 hat sich China vom Kleininvestor in Afrika zu seinem größten Wirtschaftspartner katapultiert.“
Das sichtbarste Engagement des chinesischen Regimes in Afrika ist die Entwicklung der Infrastruktur.
Die meisten der neuen Infrastrukturprojekte, wie Brücken, große Autobahnen, Wolkenkratzer und Tunnel, werden von chinesischen Firmen finanziert und gebaut.
Für den Bericht von McKinsey&Co. wurden in Afrika über 1000 chinesische Unternehmen befragt. Laut dieser Befragung waren 89 Prozent der Beschäftigten in diesen Firmen Afrikaner. Das bedeutet ca. 300.000 Arbeitsplätze.
Wenn man das auf alle 10.000 chinesische Firmen in Afrika hochrechnet, bekommen wir das Ergebnis, dass chinesische Firmen mehrere Millionen Afrikaner beschäftigen.
Verschuldungskrise der Entwicklungsländer
Was passiert aber, wenn die Entwicklungsländer, die in die „Neue Seidenstraße“ eingebunden werden, ihre Schulden nicht zurückzahlen können?
Sambia zum Beispiel steckt in einer Liquiditätskrise und hat massive Schwierigkeiten, seine Schulden an Peking zurückzuzahlen.
Die Gefahr ist laut „Africa Confidential“ so groß, dass Sambia seine Souveränität tatsächlich an China verlieren könnte. Sobald die Regierung mit ihren Krediten in Verzug gerät, kann China die nationale Vermögenswerte Sambias beschlagnahmen. Sambia bot China bereits große staatliche Vermögenswerte als Sicherheit an.
Im März 2018 hat das Center for Global Development in den USA eine Studie herausgebracht, wonach bereits 23 von 68 Entwicklungsländern aufgrund der chinesischen „Neuen Seidenstraße“ in Schuldennot geraten oder stark gefährdet sind.
Tansania wehrt sich gegen China
Tansania hat aber noch rechtzeitig die Bremse gezogen: Mitte 2019 beendete Tansania das Vorhaben, gemeinsam mit China den größten Hafen Ostafrikas in Bagamoyo, Tansania, zu bauen.
Die China Merchant Holding International sollte der künftige und einzige Hafenbetreiber sein.
Der tansanische Präsident John Pombe Magufuli sagte das Projekt ab, da er sich mit den chinesischen Investoren über „ausbeuterische und unangenehme“ Forderungen nicht einig war.
Im Economic Times of India sagte Magufuli:
„Sie wollen, dass wir ihnen eine Garantie von 33 Jahren und einen Pachtvertrag von 99 Jahren geben. Sie wollen das Land als ihr Eigenes übernehmen. Und wir müssen sie für die Bohrungen für den Bau des Hafens entschädigen.“
Die China Merchant Holding International ist ein Hafenentwickler, der bereits weltweit Anteile an Häfen besitzt. Mit dem Kauf von 49 Prozent der Anteile des Terminal Link SAS in Frankreich erhielt das Unternehmen die Betriebsrechte an fünfzehn Standorten in acht Ländern auf vier Kontinenten, darunter auch in Rotterdam und dem Panamakanal.
Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.
Aktuelle Artikel der Autorin
12. April 2025
„Made in China“ – stillgelegt
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.