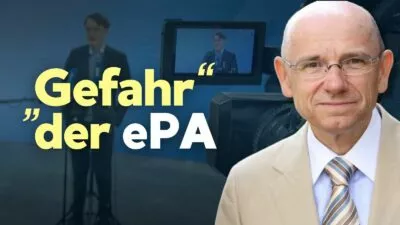Gastgeber des Festakts in Potsdam: „Vom Osten kann man lernen“ – Grüne sind stolz: „auf unsere ostdeutschen Bürgerrechtswurzeln“
Beim Festakt zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit hat Brandenburgs Ministerpräsident Woidke dazu aufgerufen, den Beitrag Ostdeutschlands im Vereinigungsprozess zu würdigen. Und auch die Grünen nutzen den Tag der Einheit, um die vergangene Zeit Revue passieren zu lassen.

Jemand hält die deutsche Flagge.
Foto: iStock
Die Zeit seit der Vereinigung 1990 bezeichnete der Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in seiner Rede am Samstag als „verbindenden Lernprozess“, den der Osten und der Westen Deutschlands durchlaufen hätten. „Es ist wichtig, dass dieser Prozess weitergeht – niemals darf er zur Einbahnstraße werden“, sagte er.
„Deshalb ist es gut, dass sich bundesweit immer öfter die Erkenntnis durchsetzt: Vom Osten kann man lernen“, sagte Woidke. Als Beispiele nannte er eine „selbstbewusste Frauenpolitik, Betriebskindergärten oder Polikliniken als Gesundheitszentren“.
Woidke zog ein gemischtes Fazit des Einigungsprozesses. „Die Deutsche Einheit ist ein großer Erfolg, und dennoch ist sie keine reine Erfolgsgeschichte“, sagte er. „Wir dürfen und wir sollten sie durchaus auch kritisch betrachten. Rückschläge, Niederlagen und Fehler gehören zu unserem Weg dazu.“
„Zerbrechlichkeit des Glücks“
Woidke erinnerte daran, dass die „Suche nach unserer gesamtdeutschen Identität für uns Ostdeutsche ein langer, manchmal schwieriger Prozess“ gewesen sei. „Viele Junge wanderten ab. Wer blieb, musste sich in aller Regel neu erfinden.“ Für viele sei „die Zerbrechlichkeit des Glücks“ eine „prägende Erfahrung“ geworden.
Das Resultat des Einigungsprozesses könne sich aber dennoch sehen lassen. „Blicken wir auf das Gesamtergebnis von 30 Jahren ‚Deutscher Einheit‘, vergleichen wir uns mit anderen Ländern, dann dürfen wir ins Schwärmen geraten“, sagte Woidke. „Millionen Menschen in ganz Deutschland engagieren sich in unserem Land in ihrer Freizeit ehrenamtlich für unsere Gemeinschaft. Sie führen auch in schwierigen Zeiten Menschen zusammen, geben uns Schwung für die Zukunft.“
Als amtierender Bundesratspräsident war Woidke Gastgeber des Festakts in Potsdam. Wegen der Corona-Pandemie waren nur 230 Gäste vor Ort zugelassen. Darunter waren mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, die Spitzen der Verfassungsorgane. Knapp die Hälfte der Gäste waren engagierte Bürgerinnen und Bürger aus allen Bundesländern.
Treffen im Hasse-Plattner-Institut
Am Vorabend des 2. Oktobers kamen rund 20 Gäste am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam zusammen. Darunter die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident, der Bundestagspräsident, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts und die Ministerpräsidenten der Bundesländer Berlin, Hamburg, Hessen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
Der Abendempfang fand an einem symbolträchtigen Ort statt. Das HPI-Hauptgebäude befindet sich auf dem ehemaligen Todesstreifen, der Ost- und Westdeutschland über Jahrzehnte teilte. Seit 1999 wird an dem von SAP-Mitbegründer Hasso Plattner gestifteten Institut international wettbewerbsfähiger IT-Nachwuchs ausgebildet und an 21 Fachgebieten exzellente universitäre Forschung zu Themen der digitalen Transformation betrieben. Das HPI expandiert auf Wunsch seines Stifters seit mehreren Jahren stark und treibt von Potsdam aus auch international technologische Innovationen voran.
Grüne: „Stolz auf unsere ostdeutschen Bürgerrechtswurzeln“
Die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck haben sich kritisch zur Rolle ihrer Partei bei der Vereinigung vor 30 Jahren geäußert. „Lieber eine linke Diktatur in der DDR als keine DDR – diese Haltung reichte teils bis in die Partei- und Fraktionsspitze“, schrieben Baerbock und Habeck in einem am Samstag veröffentlichten Gastbeitrag für das Nachrichtenportal „t-online“. „Und ja, es gab auch namhafte Grüne, deren Nähe zum SED-Regime nicht nur ideologischer Natur war.“
Baerbock und Habeck betonen zugleich den „Stolz auf unsere ostdeutschen Bürgerrechtswurzeln“. Allerdings dürfe „ein kritischer Blick zurück auf die tiefe Spaltung der westdeutschen Grünen“ nicht fehlen.
Sie schrieben: „Die Gespaltenheit und Ohnmacht der Westgrünen vor der Deutschen Frage gipfelte bei der Bundestagswahl im Dezember 1990 in dem Plakat ‚Alle reden von Deutschland. Wir reden vom Wetter.'“
Die Grünen seien damals „gefangen im gedanklichen Kontext der alten BRD“ gewesen, kritisierten Baerbock und Habeck. „Es gab einfach keine gemeinsame Basis für eine gemeinsame Antwort auf die Deutsche Frage.“ (afp/sua)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.