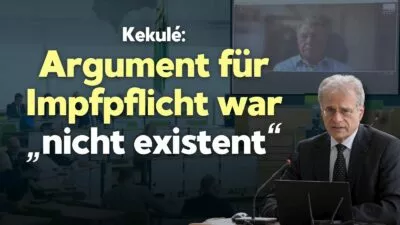Schein-Föderalismus
„Vorsätzlicher Verstoß gegen Amtseid“: Berliner Richter klagt gegen Corona-Politik
In einem Interview mit der „Welt“ übt der Berliner Richter Pieter Schleiter fundamentale Kritik an der Corona-Politik von Bund und Ländern. Mit Verfassungsbeschwerden ging er wiederholt gegen Pandemie-Bestimmungen vor. Er sieht das Grundgesetz vor einer Bewährungsprobe.

Ein Richterhammer liegt auf der Richterbank. Symbolbild.
Foto: Uli Deck/dpa/dpa
Pieter Schleiter (43), Richter in der Strafrechtsabteilung des Landgerichts Berlin, hat das „Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte“ mitgegründet. Bereits mehrfach hat er Verfassungsbeschwerden gegen Corona-Bestimmungen des Bundes und der Länder eingereicht. In einem ausführlichen Interview mit der „Welt“ erläutert er die Motivation hinter seinem offensiven Vorgehen gegen die Pandemie-Politik in Deutschland.
Berliner Richter sieht bedingten Vorsatz wie bei Autorasern
Schleiter hält die Corona-Politik in Deutschland für „verfassungswidrig“.
Auf die Frage, ob er den handelnden Personen Absicht unterstelle, erläutert der Strafrichter, dass zwar wohl nicht diese als höchste Stufe des Tatvorsatzes im juristischen Sinne anzunehmen sei.
Lege man jedoch die Definition für den bedingten Vorsatz [nach Absicht und Willentlichkeit die schwächste Vorsatzform im Strafrecht; ET] im Hinblick auf eine Verletzung des Amtseids an, wäre das Handeln der Verantwortlichen durchaus als vorsätzlich zu qualifizieren:
„Wenn ein Politiker es für möglich hält, dass er gegen die Verfassung verstößt, aber trotzdem handelt, weil es ihm wichtiger ist, ein anderes Ziel zu verfolgen, dann ist das vorsätzlich im juristischen Sinne. Das gilt ähnlich für einen Raser, der eine Tötung zwar nicht beabsichtigt, aber billigend in Kauf nimmt – und zwar auch dann, wenn er es nur für möglich hält, dass durch sein Handeln jemand ums Leben kommt.“
Kein Widerstandsrecht gegen Corona-Regeln – könnte sich aber ändern
Der Jurist betont, sich an die Regeln zu halten, auch wenn er sie für verfassungswidrig erachte. Immerhin habe es einen Eigenwert, Gesetze zu befolgen, um Anarchie zu vermeiden. Zudem befinde sich das, was den Bürgern durch die Corona-Regeln auferlegt wäre, noch nicht in einem Bereich, wo eine Art Widerstandsrecht gegeben wäre.
Dies könne sich jedoch ändern: „Wenn die Rechtslage in zwei oder drei Jahren noch so wäre wie jetzt, müsste man sich neue Gedanken machen.“
Grundrechte seien gerade für Krisenzeiten da, betont der Richter. Er habe zum ersten Mal grundsätzliche Bedenken bezüglich der Pandemie-Regeln bekommen, als Anfang April des Vorjahres der Lockdown verlängert wurde, obwohl der R-Wert bereits seit 22. März unter 1 gelegen hätte und die Gefahr einer exponentiellen Ausbreitung des Virus damit gebannt war.
Kritiker nicht mehr eingeladen
Die Politik habe sich jedoch über die Beraterebene von unterschiedlichen Perspektiven abgeschottet und auch Anfang Januar nur Mediziner, Epidemiologen und Physiker statt Psychologen, Ökonomen oder Staatsrechtler angehört, bevor in der Bund-Länder-Konferenz über die Verlängerung des harten Lockdowns entschieden worden sei. Man könne sich jedoch nur eine Meinung bilden, wenn man alle Seiten höre.
Dabei habe es nicht nur bereits Anfang April 2020 Bedenken des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages bezüglich der Verfassungskonformität der damaligen Änderungen des Infektionsschutzes gegeben. Auch im Rahmen der Anhörungen im Gesundheitsausschuss im Vorfeld der Novellierung im November 2020 habe es kritische Stellungnahmen von Verfassungsjuristen gegeben. Sie seien im Januar dann gar nicht erst angehört worden.
Fehlende Abwägung
Derzeit gehe die Tendenz dahin, dass dem übergeordneten Ziel des Gesundheitsschutzes alles andere untergeordnet würde. Es gäbe aber nicht das „Supergrundrecht Leben“, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Bedürfnisse von 83 Millionen Menschen in Deutschland, die durch einen umfassenden Kanon an Grundrechten geschützt seien.
„Diese Rechte sind auch Abwehrrechte gegenüber dem Staat“, unterstreicht Schleiter. Wolle der Staat darin eingreifen, müsse er dies in jedem Fall legitimieren und notfalls eine Güterabwägung vornehmen. In der Pandemie seien über 80 Prozent dieser Grundrechte betroffen – diese Abwägung sieht er jedoch nicht.
Zudem stehe nicht einmal fest, ob dem vorgeblichen Ziel des Gesundheitsschutzes überhaupt Genüge getan werde: Immerhin müsse auch in die Abwägung einbezogen werden, dass Lockdown-bedingte Arbeitslosigkeit die Suizidrate steigere und fehlende Schulbildung auch die längerfristige Lebensqualität von Schülern beeinträchtige.
Bund-Länder-Konferenz schaffe Schein-Föderalismus
Die derzeitige Rechtswirklichkeit, so resümiert der Jurist, ähnelt jener einer Notstandsverfassung, „aber unter Unterlaufen des gesetzlichen Gefüges“. Bis hin zum Föderalismus – dem nur scheinbar durch die Bedeutung der Bund-Länder-Konferenz Genüge getan werde. Das Föderalismusprinzip solle gewährleisten, dass in Grundrechte nur dort eingegriffen werde, wo dies erforderlich sei:
„Jetzt erlassen zwar formal die Länder ihre Verordnungen – aber nach einem Abstimmungsprozess in einem Gremium, das im Grundgesetz nicht vorgesehen ist.“
Der Rechtsstaat und die Verfassung stünden nun vor einer Bewährungsprobe, und die Justiz trage dabei eine hohe Verantwortung. Es sei noch nicht absehbar, ob sie dieser gerecht werde.
Aktuelle Artikel des Autors
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.