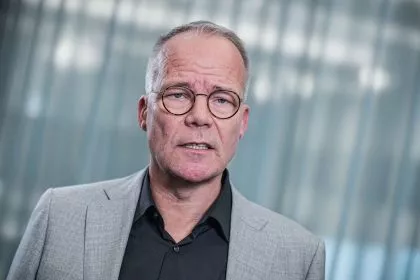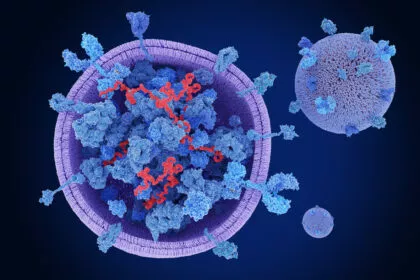Das in der Nacht zum Donnerstag (4.6.) geschnürte
Konjunkturpaket der Bundesregierung zur Bewältigung der Corona-Folgen hat mit einem Volumen von 130 Milliarden Euro die von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder anvisierte Obergrenze noch einmal um 30 Prozent überschritten.
Dazu kommt noch der deutsche Beitrag zum 540-Milliarden-Kreditprogramm der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Europa und zum 500-Milliarden-Euro-Programm für die wirtschaftliche Erholung der am stärksten betroffenen EU-Staaten. Die drei Milliarden an Hilfe für afrikanische Staaten im Rahmen des „Compact with Africa“ fällt vor diesem Hintergrund kaum ins Gewicht.
Für sechs Monate wird es an der Supermarktkasse wieder 2005
Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von einer „mutigen Antwort“ auf die Krise. Und manch einem kommt der vorgezogene Bundestagswahlkampf des Jahres 2005 in den Sinn. Auf dem Höhepunkt einer Phase der Massenarbeitslosigkeit und wenige Monate nach Einführung der ALG-2-Reform („Hartz IV“) ging Merkel mit der Ankündigung in den Wahlkampf, die Mehrwertsteuer von damals 16 auf dann 18 Prozent zu erhöhen. Die SPD hielt dagegen. Am Ende einigte sich die GroKo auf ein Plus von drei Prozent.
Die Mehrwertsteuer wird ab 1. Juli wieder auf den Stand der Zeit vor Merkels Übernahme des Kanzlerpostens zurückgeschraubt – für die Dauer von sechs Monaten. Länger wird sie wohl nicht auf dem Stand bleiben. Denn, so schreibt Margarete van Ackeren im
„Focus“:„Es wird das letzte Mal gewesen sein, dass der Bund die Rufe nach Hilfen mit größter Offenheit erhörte. Das Ende der Fahnenstange ist in Sicht.“
Immerhin gab es zuvor schon auf nationaler Ebene ein Paket für Beschäftigte, Selbständige und Unternehmen, das 353,3 Milliarden Euro an Hilfen und 819,7 Milliarden Euro für Garantien umfasste. Um dieses Paket zu finanzieren, musste der Bund schon neue Kredite in Höhe von etwa 156 Milliarden Euro aufnehmen.
„Keine Alternative zu Konjunkturpaket“
Van Ackeren schreibt nicht, es hätte zu dem Vorgehen keine Alternative gegeben. Sie macht nur deutlich, dass das 130-Milliarden-Konjunkturpaket doch auch ein Hochrisikomanöver darstellt. Greift das Paket nicht wie erhofft, gehen der Politik die Optionen aus.
Die Focus-Online-Korrespondentin gibt dem Paket eine intakte Chance, sein Ziel zu erreichen. Zwar sei offensichtlich, dass der einmalige Kindergeld-Bonus von 300 Euro, der für Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die SPD einen wichtigen symbolischen Sieg darstellt, ein kleines Strohfeuer ohne breite Wirkung darstelle. Auch das Bekenntnis, mittels „Sozialgarantie“ die Lohnnebenkosten nicht über 40 Prozent steigen lassen zu wollen, sei eher als plakative Absichtserklärung zu verstehen, sofern man das Absicherungsniveau beibehalten wolle.
Insgesamt aber leiste das Paket, was es leisten sollte: Es setze einen „starken Konsum-Impuls für die gesamte Breite der Wirtschaft“ und wirke vor allem psychologisch. Das Paket, so van Ackeren, sei „dick und kreativ genug, um mit der großen Milliarden-Zahl auch den nötigen Stimmungsumschwung anzustoßen“.
Deutlich enthusiastischer bewertet die weit linke „Süddeutsche Zeitung“ das Paket. Dort
sieht Cerstin Gammelin eine kraftvolle Besinnung auf die Kernüberzeugungen des Keynesianismus und den Anfang vom Ende des „neoliberalen“ Sparkurses, der darauf bedacht war, künftige Generationen nicht mit Schulden zu überhäufen.
„Süddeutsche“: Corona-Paket markiert „bemerkenswerte Wende“ gegenüber 2010
Im Gegenteil, meint Gammelin: „Nur massive Investitionen helfen den jüngeren Generationen.“ In diesem Sinne handele es sich um ein „historisches“ Paket, das „zeigt, wie sehr sich Deutschland verändert hat“.
Scholz wolle „mit Wumms aus der Krise“ – und der Weg dazu sei ein Ankurbeln der Binnenkonjunktur durch Förderung des privaten Konsums und Investitionen der Unternehmer. Mehrwertsteuersenkung, Kinderbonus, verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten bei Investitionen oder eine Bremse beim Strompreis seien nur einige Aspekte eines Pakets, das diesem Zweck dienen soll und noch mehr.
Diesmal wolle die Koalition aber – anders als nach der Wirtschaftskrise 2008 – nicht auf Kosten der sozial Schwachen sparen. Dies sei „eine bemerkenswerte Wende“:
„Die große Koalition greift weder auf die klassischen Instrumente, etwa eine Abwrackprämie, zurück noch auf die klassischen Kürzungspotenziale, wie etwa 2010, als die schwarz-gelbe Koalition ein gewaltiges Sparpaket verabschiedete. Mehr als 80 Milliarden Euro sollten eingespart werden, vor allem mit sozialen Kürzungen. Die große Koalition macht nun genau das Gegenteil, sie stärkt die sozial Schwachen.“
Teil der Milliarden geht auch in langfristige Investitionen
Zwar könne niemand seriös voraussagen, wie groß der Effekt dieser Maßnahmen sein werde und „jeder Euro, den die Regierung jetzt ausgibt, den ökologischen Wandel befördern wird“. Aber unstrittig sei, „dass es der richtige Ansatz ist“.
In der
„Welt“ spricht Thomas Vitzthum davon, dass der Koalition vor allem ein „psychologischer Coup“ gelungen sei. Den Koalitionsparteien sei zum Teil klar gewesen, dass sie in vielen Bereichen gegen eigene Erkenntnisse gestimmt hätten – etwa, dass Konsumanreize wie der Kinderbonus Kaufentscheidungen nur vorverlagern würden. Auch greife das Paket für Clubs oder Schausteller, deren Einnahmen auch in der zweiten Jahreshälfte nicht gesichert wären, zu kurz.
Andererseits wolle man eben jetzt und hier Nachfrage generieren – und neben den kurzfristigen Impulsen beinhalte das 130-Milliarden-Paket auch ambitionierte und langfristige Zukunftsprojekte – von der künstlichen Intelligenz bis hin zum Wasserstoffauto.
„Nun kommt es auf den Bürger an“, schreibt Vitzthum. „Auf den mündigen Bürger. Denn die Politik hat die Rechnung mit Konsumenten gemacht, die wieder konsumieren wollen, und mit Unternehmen, die sich nicht unterkriegen lassen, die gut und schlau genug sind, Abnehmer zu finden.“
Scholz: Dimensionen des Pakets sind „überschaubar“
Ob die Mehrwertsteuersenkung zu günstigeren Preisen im Handel führen oder sich die Händler ihre Kosten für Pandemiemaßnahmen darüber wieder hereinholen werden, sei noch nicht abzusehen. Ab wann der Konsumeffekt greifen wird, ebenso wenig.
Erst am gestrigen Mittwoch
hieß es in der gleichen Zeitung, die Maskenpflicht bringe die Konsumenten dazu, nur noch zu kaufen, was wirklich notwendig sei. Die Einkäufe würden auch in ihrer Dauer darauf reduziert – das Shopping-Erlebnis zum Zwecke der Freizeitgestaltung bleibe aus.
Vitzthum zeigt sich zudem etwas irritiert über die Sicherheit, mit der Olaf Scholz von „überschaubaren“ Dimensionen des Konjunkturpakets spricht – während es um 90 Milliarden Euro für 2020, 30 Milliarden für 2021 und zehn Milliarden gehe, die die Länder aufbringen müssten. Da erst vor wenigen Wochen ein Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro beschlossen worden sei, von dem nur noch 60 Milliarden übrig seien, wäre schon bald der nächste fällig. Dass Scholz dennoch gelassen bleibe, sei gewollt:
„Auch das ist eben Teil der Psychologie dieses Pakets. Es ist die Botschaft: Deutschland kann das, wir haben es ja. Hoffentlich kann sich Deutschland nach der Krise den Gang zum Psychologen sparen.“