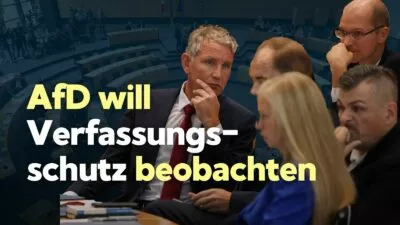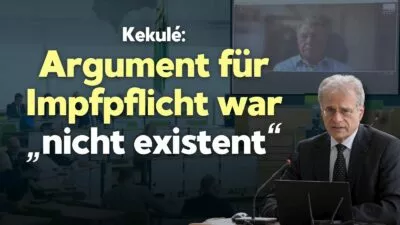Der Staat will mehr Einfluß auf die Bildung – Baden-Württemberg ist gegen eine entsprechende Änderung im Grundgesetz
"Süßes Gift" nennt Ministerpräsident Kretschmann zeitlich befristete Mittel des Bundes für die Bildung. Er kritisiert die geplante Grundgesetzänderung zur Aufhebung des Kooperationsverbotes.

Der Lehrerverband fordert eine bundesweite Corona-Ampel für Schulen.
Foto: iStock
Die Landesregierung Baden-Württembergs stemmt sich gegen die vom Bund geplante Grundgesetzänderung bei der Bildungsfinanzierung. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) warnte am Dienstag in Berlin vor Kompetenzverlusten der Länder zugunsten des Bundes.
Unstrittig sei zwar, dass die Länder mehr Geld bräuchten. Das könne man aber auch über die Steuerverteilung ausverhandeln. Hingegen seien zeitlich befristete Programmmittel des Bundes „süßes Gift“, mit dem der Bundeseinfluss auf Länder und Kommunen in einem beispiellosen Umfang ausgeweitet werden solle, kritisierte der Grünen-Politiker.
CDU, CSU und SPD hatten in den Koalitionsverhandlungen vereinbart, das Grundgesetz zu ändern, damit der Bund sich stärker an der Finanzierung der Bildungsinfrastruktur beteiligen kann. Konkret geht es um die Auszahlung des Digitalpakts Bildung des Bundes, der 2019 starten soll.
Ab dann sollen fünf Milliarden Euro in fünf Jahren an die Kommunen fließen. Das Geld soll der Ausstattung an den Schulen zugutekommen.
Für die angestrebte Grundgesetzänderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag nötig, die die große Koalition aber nicht hat. Zudem muss das Vorhaben auch durch den Bundesrat. Kretschmann sagte, die Ministerpräsidenten der Länder wollten sich bei ihrem nächsten Treffen im Herbst mit dem Thema befassen.
Das umstrittene Kooperationsverbot in der Bildung
FDP-Chef Christian Lindner kritisierte die Haltung von Kretschmann scharf. Der Grünen-Politiker wolle eine überfällige Reform des Bildungsföderalismus torpedieren, erklärte Lindner in Berlin.
„Es ist widersinnig, dass Kooperation zwischen Bund und Ländern verboten ist. Selbst die föderale Schweiz ist weiter als Deutschland“, befand der FDP-Politiker. Die Pläne der Bundesregierung seien ein kleiner Schritt, der aber immerhin in die richtige Richtung gehe.
Im Grundgesetz ist festgelegt, dass der Bund in Deutschland nicht in die förderale Bildungspolitik eingreifen darf, Bildung ist Sache der Bundesländer.
Das Kooperationsverbot wurde nach dem 2. Weltkrieg beschlossen und basiert auf den Erfahrungen mit der Zentralisierung der Bildung in Deutschland bis 1945. Der Bund nimmt jedoch über finanzielle Mittel bereits Einfluss auf die Bildungspolitik.
Dezentale Bildungspolitik setzt Politiker unter Druck – an der Wahlurne
Jan Schnellenbach von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus schreibt zur Bildungspolitik, dass das Kooperationsverbot nützlich ist. Denn es macht Bildung vergleichbar und setzt Politiker einem Wettbewerb aus.
Eine dezentrale Bildungspolitik erlaubt vor allem, die Bildung an die regionalen und lokal unterschiedlichen Bedingungen anzupassen.„Sie setzt die Politiker dem aus, was man yardstick competition nennt, also einem Maßstabswettbewerb. Die Bürger in Berlin beobachten, wie schlecht ihre Schulen im Verhältnis zu Bayern sind, und wenn ihnen an diesem Thema etwas liegt (was man leider nicht immer voraussetzen kann), dann werden sie ihre Bildungspolitiker an der Wahlurne für ihre Fehlleistungen bestrafen.“
Falch und Fischer bewiesen 2012, dass Länder in internationalen Bildungsvergleichen mit zunehmender Dezentralisierung besser abschneiden, auch in einer OECD-Studie konnte dieser Zusammenhang durch Fredriksen (2013) nachgewiesen werden.
Ohne Bildungswettbewerb sinkt das Niveau
Jan Schnellenbach erklärt: „Die Forderung der SPD nach Zentralisierung und Aufhebung des Kooperationsverbotes unterminiert nicht nur den deutschen Föderalismus, was für sich genommen schon schlimm genug wäre. Vielmehr ist diese Forderung nicht einmal sinnvoll im Hinblick auf das proklamierte Ziel, die Bildungsqualität in Deutschland nachhaltig zu verbessern“
Denn es ist zu befürchten, dass „wir uns ohne föderalen Wettbewerb nicht etwa auf dem Niveau von Bayern wiederfinden, sondern nach unten nivelliert, auf dem Niveau von Bremen, NRW oder gar Berlin.“
(dpa/ks)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.