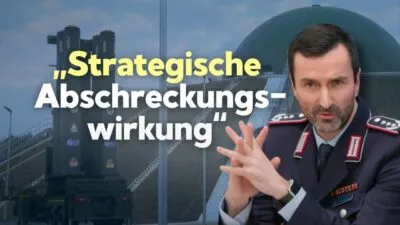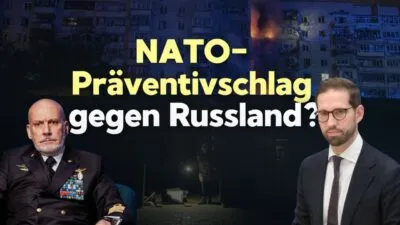Nahrung und Umwelt
WEF-Plan: Mit „Grüner Gentechnik“ den Klimawandel bekämpfen
Forscher sind momentan dabei, gravierend in die Natur einzugreifen. Es geht um unser Essen. Mittels Gentechnik sollen Pflanzen zur Nahrungsmittelproduktion so verändert werden, dass sie bestimmte Klimaziele besser erreichen können.

Eine Forscherin untersucht eine Pflanzenprobe in einem Labor. Symbolbild.
Foto: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)
Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat vor Kurzem einen Plan vorgestellt, wonach Nahrungsmittel- und Klimakrise gemeinsam betrachtet werden müssen. Die Teilnehmer sehen in den globalen Nahrungsmittelsystemen eine negative Beeinflussung des Klimawandels, die mittels Gentechnik gemindert werden könne. Wissenschaftler entwickeln daher eine Reihe von gentechnisch veränderten Nutzpflanzen. Diese sollen künftig Kohlendioxid (CO₂) effizienter aus der Atmosphäre entfernen und speichern.
Mit anderen Worten: Die sogenannte „Grüne Gentechnik“ soll direkt mit unserer Nahrungsmittelversorgung kombiniert werden. Hierbei werden gentechnische Verfahren im Bereich der Pflanzenzüchtung angewendet. Das Ergebnis solcher Verfahren sind gentechnisch veränderte Pflanzen und gentechnisch veränderte beziehungsweise gentechnisch manipulierte Organismen (GVO/GMO).
Klimaziele vor Nahrungsmittelproduktion
Mehr als ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen entfallen auf die Ernährungssysteme. Das stellt das WEF unter Berufung auf einen Bericht der UN fest. Es ginge auch um das Erreichen der Emissionsziele des Pariser Abkommens. Dabei wollen die Teilnehmer die Treibhausgasemissionen auf einen Wert nahe null reduzieren. Zudem sollen die neuen Lösungen die verbleibenden Emissionen aus der Atmosphäre absorbieren.
Der Lösungsansatz sieht sowohl bei Pflanzen- als auch der Tierzucht Veränderungen vor. Pflanzen sollen so konstruiert werden, dass sie CO₂ noch effizienter aufnehmen und in Sauerstoff umwandeln oder im Boden speichern. Die Forscher wollen also den grundlegenden Prozess der Photosynthese nach ihren Wünschen abändern. Im Bereich der Viehzucht sollen die genutzten Flächen aufgrund der Methanemissionen reduziert werden. Man will also auch den Fleischkonsum der Menschen einschränken.
Gentechnik gegen Klimawandel
Die Gentechnik wird bereits eingesetzt, um Organismen bei der Anpassung an neue Klimabedingungen zu helfen. Forscher entwickeln Reis-, Mais- und Weizensorten, die längeren Dürreperioden und feuchteren Monsunzeiten standhalten können. Extreme Temperaturen setzen Nutzpflanzen neuen Pilzen und Schädlingen aus, was Wissenschaftler dazu veranlasst, krankheitsresistente Maniok-, Kartoffel- und Kakaopflanzen gentechnisch zu entwickeln.
Die Forscher setzen zur Bekämpfung des Klimawandels die gleichen gentechnischen Instrumente wie die zur Anpassung an den Klimawandel ein. Gefördert werden diese Forscher von der Chan-Zuckerberg-Initiative. Ein weiterer Förderer ist die National Science Foundation. Diese finanziert unter anderem das Projekt „Realizing Increased Photosynthetic Efficiency“.
So haben beispielsweise die Forscher der Harnessing Plants Initiative herausgefunden, dass man Wurzeln so verändern kann, dass sie stabiler, größer und tiefer werden. Durch die Verwendung eines Moleküls, das in Avocado- und Melonenschalen vorkommt, könnten diese künstlichen Wurzeln der Zersetzung besser widerstehen, sodass weniger Kohlenstoff entweicht. Ebenso können Mikroben im Boden zur Kohlenstoff-Bindung genutzt werden.
Bindung von Kohlenstoff durch andere Ökosysteme
Mehr als ein Drittel der globalen Landfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Jedoch würde den Teilnehmern des WEF bereits ein Bruchteil dieser Flächen für eine effizientere Absorption und Speicherung von Kohlenstoff durch technische Pflanzen genügen, um ihre Ziele zu erreichen.
Ein weiterer Ansatzpunkt zur CO₂-Bindung ist die strategische Aufforstung auf globaler Ebene. Dadurch könnten jährlich rund 40 Milliarden Tonnen CO₂ verringert werden. Ein einziger Baum bindet in seinem Leben durchschnittlich 0,62 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent.
Der Ozean und die „Blue Carbon“-Ökosysteme – Salzwiesen, Mangroven und Seegräser – stehen ebenfalls auf der Agenda. Sie sind bei der Bindung von CO₂ pro Jahr und Fläche zehnmal effektiver als tropische Wälder. Sie haben das Potenzial, bis 2050 fast 1,4 Milliarden Tonnen CO₂ zu absorbieren.
Grasland hat auch ein großes Potenzial für die Kohlenstoffspeicherung. In zunehmend trockenen Gebieten können Graslandschaften mehr Kohlenstoff speichern als Wälder, da sie weniger von Dürren und Waldbränden betroffen sind. Sie binden den meisten Kohlenstoff unterirdisch, während Bäume ihn hauptsächlich in Holz und Blättern speichern, die anfällig für Feuer sind.
Folgen für die Gesundheit
Die Gentechnik-Forschung kann bei nicht ausreichender Entwicklung und Erprobung auch gesundheitliche und ökologische Risiken mit sich bringen. Welche Auswirkungen diese „Grüne Gentechnik“ auf den Menschen hat, der diese Nahrungsmittel zu sich nimmt, wird in dem WEF-Bericht nicht erörtert.
Viele Menschen sind gegenüber GMOs skeptisch, weil die langfristigen Auswirkungen oftmals nicht bekannt sind. Mögliche Nebenwirkungen können etwa Allergien oder Schäden im Darmsystem sein.
Im vergangenen Jahr hat eine Studie einer kanadischen Universität bestätigt, dass Giftstoffe genetischen Ursprungs problemlos in den Blutkreislauf gelangen. Das kann den Stoffwechsel des Menschen beeinflussen und Reaktionen auslösen.
Das Gentechnikrecht in der EU
Die Europäische Kommission strebt bereits seit einigen Monaten an, das Gentechnikrecht der EU aufzuweichen. Sie plant, bestimmte gentechnisch veränderte Organismen von den bestehenden Vorschriften auszunehmen. Somit sollen die Agrarkonzerne sie ohne entsprechende Zulassung, Rückverfolgbarkeit oder Kennzeichnung vermarkten können.
Unter den großen Agrarkonzernen befinden sich Bayer/Monsanto und Corteva (ehemals DowDuPont). Sie setzen sich seit Langem dafür ein, dass die EU ihre Gentechnikgesetze nur auf gentechnisch veränderte Pflanzen anwendet, bei denen artfremde DNA ins Erbgut eingeschleust wurde. Sie wollen, dass mittels neuer Gentechnikverfahren wie CRISPR hergestellte Pflanzen nicht als gentechnisch verändert eingestuft werden.
Im April dieses Jahres unterstützte die EU-Kommission erstmals öffentlich diesen Standpunkt. Dabei kündigte sie an, einen gesonderten Rechtsrahmen für solche gentechnisch veränderten Pflanzen schaffen zu wollen. Die Kommission verzichtet dabei auf das Wort „Gentechnik“. Stattdessen bezeichnet sie diese Pflanzen lieber als „Pflanzen, die mithilfe bestimmter neuer genomischer Verfahren gewonnen werden.“
Die Pläne der Kommission stehen in direktem Widerspruch zum Europäischen Gerichtshof (EuGH). Das oberste Gericht der EU warnte, dass ein Ausschluss von Organismen, die mit neuen gentechnischen Verfahren hergestellt wurden, aus dem Anwendungsbereich des EU-Gentechnikrechts dessen Zweck beeinträchtigen würde. Der Schutz von Gesundheit und Umwelt würde damit geschwächt.
Das Fachgebiet von Maurice Forgeng beinhaltet Themen rund um die Energiewende. Er hat sich im Bereich der erneuerbaren Energien und Klima spezialisiert und verfügt über einen Hintergrund im Bereich der Energie- und Gebäudetechnik.
Aktuelle Artikel des Autors
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.