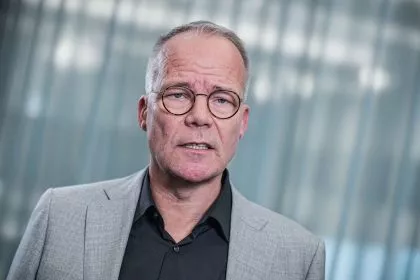Schlechte Arbeit oder psychologische Kriegsführung? Kritik an Meinungsforschern nach US-Wahlen
In einem zum Teil noch größeren Ausmaß als 2016 lagen die Meinungsforscher mit ihren Prognosen zur US-Präsidentschaftswahl am Dienstag neben den realen Ergebnissen. Dafür müssen sie herbe Kritik aus beiden politischen Lagern einstecken.

In der Nähe des Weißen Hauses in Washington, D.C., am 5. November 2020.
Foto: SAUL LOEB/AFP über Getty Images
Voraussichtlich im Laufe des Donnerstags (5.11.) werden die Stimmen zu den Präsidentschaftswahlen in den USA so weit ausgezählt sein, dass – vorbehaltlich allfälliger Wahlanfechtungen – ein voraussichtlicher Sieger feststeht. Einen Verlierer kennen die Wahlen aber jetzt schon: die Meinungsforscher.
Sie lagen mit den Umfragewerten, die sie im Vorfeld der Wahl präsentiert hatten, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf der Ebene der meisten Einzelstaaten so weit daneben, dass sie nun mit heftiger Kritik aus den Reihen der Republikaner wie auch der Demokraten konfrontiert sind. Das berichtet „The Epoch Times“.
Mobilisierung führte zu Rekord bei der Wahlbeteiligung
Einige Faktoren stachen bei dieser Wahl in besonderer Weise heraus: Dazu gehörte ein Rekord bei der Wahlbeteiligung. Wie „Fox News“ berichtet, zeichnet sich ab, dass der demokratische Kandidat Joe Biden am Mittwochabend mit mehr als 72 Millionen Stimmen landesweit die bislang meisten Stimmen erzielt hat, die je ein US-Präsidentschaftskandidat für sich verbuchen konnte.
Der bisherige Rekord stammte mit 69.498.516 Stimmen aus dem Jahr 2008 und wurde von Barack Obama aufgestellt. Neben einer um 26 Millionen Menschen angewachsenen US-Bevölkerung seit 2008 hat auch eine noch nie gekannte Mobilisierung eine Rolle gespielt.
Denn auch Amtsinhaber Donald Trump hat seine Stimmenanzahl aus dem Jahr 2016 deutlich ausbauen können und liegt derzeit bei 68,5 Millionen Stimmen. Auch er könnte Obamas alten Rekord noch schlagen. Im Unterschied zu früheren Wahlen entschied diesmal die Strategie möglichst hoher Mobilisierung der eigenen Anhänger bei gleichzeitiger Demobilisierung des gegnerischen Lagers. Diese nützt vor allem Kandidaten, die ein Mindestmaß an Charisma aufweisen, der eigenen Anhängerschaft als glaubwürdig erscheinen und gleichzeitig die Gegenseite nicht durch eine zu stark polarisierende Politik provozieren.
Diese hatte unter anderem 2004 den Ausschlag gegeben für die Wiederwahl von George W. Bush und 2012 für jene Obamas. In Deutschland galt Bundeskanzlerin Angela Merkel lange Zeit als Meisterin dieses Fachs. Bei den diesjährigen US-Präsidentschaftswahlen war hingegen die maximale Mobilisierung auf beiden Seiten ausschlaggebend – der glühenden Anhänger Trumps wie seiner entschiedenen Gegner.
Biden-Vorsprung auf bis zu 17 Punkte eingeschätzt
Die Demoskopen hatten allerdings offenbar nur eine Seite bezüglich der Mobilisierung auf dem Schirm, zeigt eine Übersicht der „The Epoch Times“. In der letzten Umfrage von Siena College Poll für die „New York Times“ unmittelbar vor dem Wahltag war die Rede von einem erheblichen Vorsprung, den Joe Biden in vier entscheidenden Battleground States aufweise.
Bedingt durch eine erhebliche Mobilisierung von Wählern, die 2016 der Urne ferngeblieben waren, würde Biden in Wisconsin mit elf Punkten voranliegen, in Pennsylvania und Arizona mit sechs und in Florida mit drei.
Am Wahlabend gewann Trump in Florida, in Wisconsin liegt Biden bei 99 Prozent Auszählungsgrad mit 0,7 Prozent voran, in Pennsylvania, wo noch bis Freitag gezählt werden kann, liegt Trump vorne und in Arizona, wo die Familie des früheren republikanischen Senators John McCain Biden unterstützt hatte, lag dieser nur mit drei statt mit sechs Punkten voran. Die Demoskopen hatten zwar offenbar die starke Mobilisierung des Biden-Lagers einkalkuliert, nicht aber den Enthusiasmus der Trump-Wähler.
Noch weiter daneben lagen die „ABC/Washington Post“-Umfrage, die Biden kurz vor der Wahl einen Vorsprung von 17 Prozent in Wisconsin eingeräumt hatte, und eine des „Guardian“ von Mitte Oktober, die Biden im Popular Vote mit dem gleichen Abstand voran sah.
Ähnliche Fiaskos in Großbritannien
Auch der Real Clear Politics Poll, der regelmäßig einen Mittelwert aus 13 größeren Umfrageinstituten errechnet, wies einen landesweiten Vorsprung Bidens von 7,5 Punkten aus, der sich auch im Popular Vote nicht in dieser Form abbilden wird.
Die englischsprachige Epoch Times weist darauf hin, dass das gleiche Problem auch aus Großbritannien bekannt ist, wo 2016 fast alle größeren Umfrageinstitute bei der Brexit-Abstimmung ein Ja zum Verbleib in der Europäischen Union prognostiziert hatten – und am Ende 52 Prozent die Briten aus der EU herauswählten.
Auch bei den Unterhauswahlen des Vorjahres gingen Meinungsforscher lediglich von einem knappen Sieg der Konservativen aus. Die Partei von Premierminister Boris Johnson gewann jedoch mit der größten Mehrheit seit 1987, als die Tories noch von Margaret Thatcher geführt worden waren.
Unvermögen oder Absicht?
Die Zahlen der Umfrageinstitute hatten bereits im Vorfeld der Wahl Argwohn und Missbilligung ausgelöst, vor allem im konservativen Lager. Donald Trump selbst sprach von „Fake-Polls“.
In sozialen Medien mutmaßten Nutzer, die Demokraten würden die Demoskopie als Instrument der psychologischen Kriegsführung missbrauchen, um potenzielle Trump-Wähler zu demoralisieren – und dass die Umfrageinstitute sich dafür ungeachtet des Risikos hergeben würden, durch ungenaue Ergebnisse an Glaubwürdigkeit auf dem Markt zu verlieren.
In der Vergangenheit hatten demgegenüber liberale Kommentatoren Sender wie „Fox News“ beschuldigt, durch die Präsentation ungünstiger Umfragewerte für republikanische Kandidaten einen Mobilisierungseffekt bei noch nicht zur Wahl entschlossenen Sympathisanten zu bewirken.
Kritik auch von Strategen der Demokraten
Im Interview mit der Epoch Times kritisierten Strategen beider Parteien die Meinungsforscher und warfen ihnen vor, im Bereich der wahrscheinlichen Wähler die Demokraten zu hoch zu veranschlagen und das Phänomen der „scheuen Trump-Wähler“ zu vernachlässigen, die ihre Absichten verschweigen.
Kevin Chavous, ein Stratege der Demokraten aus Washington, D. C., nennt die Demoskopen „die größten Verlierer der vergangenen Nacht, […] insbesondere auch bezüglich der staatenspezifischen Umfragen“.
Die Umfrageinstitute hätten „noch weiter danebengelegen als 2016“, viele hätten Biden noch fünf Tage vor der Wahl mit zweistelligem Abstand in Führung gesehen. Scheue Trump-Wähler seien dabei ein unterschätzter Faktor gewesen, meint Chavous, aber nicht die einzige Erklärung für die ungenauen Zahlen so vieler Institute“.
Cristina Antelo von Ferox Strategies, ebenfalls in Diensten der Demokraten tätig, sieht die Diskrepanz zwischen Enthusiasmus und Bekenntniseifer bei Trump-Anhängern als ein Problem, mit dem Demoskopen noch länger konfrontiert sein könnten:
„Meinungsforscher wissen einfach nicht, wie sie den Trumpismus einkalkulieren sollen. Sie werden jetzt einige Analysen präsentieren, in denen sie zeigen werden, dass sie nicht so falsch gelegen hätten wie es aussieht, aber sie verfehlen eine komplette Stimmungslage und eine Bevölkerungsgruppe und wissen nicht, wie sie das korrigieren sollen.“
„Republikaner um mindestens vier bis fünf Punkte unterbewertet“
Matt Mackowiak von der Potomac Strategy Group erklärte:
„Öffentliche Umfragen sind billig, schlecht gemacht und bewerten Demokraten über. Die gesamte Industrie sollte aufgelöst werden und zurück in den Statistikkurs gehen.“
Seton Motley von Less Government betonte, man misstraue den Umfrageinstituten, weil diese „von ihrem gewünschten Resultat ausgehen und dann die Befragung durchführen, bis sie die dazu passenden Zahlen haben“.
Tom Schatz von Citizens Against Government Waste President erklärte gegenüber der Epoch Times, es gäbe einige Umfrageinstitute, die zumindest etwas näher am Endergebnis gelegen hätten, wie Rasmussen oder Trafalgar, aber die meisten hätten „Republikaner um mindestens vier bis fünf Punkte unterbewertet“.
Weitere Experten bezeichneten politische Umfragen als „Geldverschwendung“ und verwiesen darauf, dass Bootsparaden und Kundgebungen für Trump mit großen Teilnehmerzahlen bereits ausreichenden Hinweis darauf geben, dass es ein erhebliches Mobilisierungspotenzial aufseiten des Präsidenten gibt.
Hans von Spakovsky von der Heritage Foundation führt auch das intolerante und gewaltaffine Meinungsklima der vergangenen Monate als Faktor an, der in der öffentlichen Bekenntnisfreude zu Verzerrungen führe:
„Leute, die Biden-Werbetafeln in ihren Garten setzen, haben keine Angst vor Vandalismus. Leute, die solche für Trump postieren, haben diese aber.“
Vertrauen in Meinungsforscher könnte weiter sinken
Zach Friend, ehemaliger Pressesprecher von „Obama for America“, erklärte, Umfragen sollten „eine Auswahl an Menschen, von der man glaubt, sie seien repräsentativ für die breite Bevölkerung zu einem gegebenen Zeitpunkt“ abbilden. Gelinge dies den Meinungsforschern nicht, könnte die Branche eine ernste Krise erleben:
Aktuelle Artikel des Autors
25. April 2025
SPD fordert Rentengarantie und Mietpreisbremse bis Juli
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.