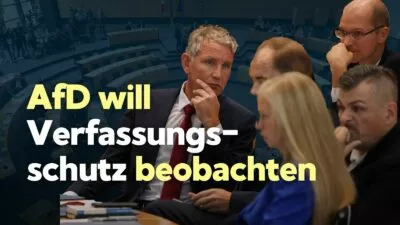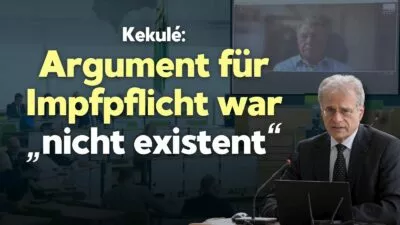EU-Sondergipfel: Orbans Veto-Drohung und Merkels Prioritäten

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban reisen ab, nachdem sie vor den Gesprächen im Kanzleramt am 10. Februar 2020 in Berlin vor den Medien gesprochen haben. Foto von Sean Gallup/Getty Images
Es ist eines der heikelsten Themen im EU-Haushaltsstreit: Können EU-Gelder künftig bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit gekürzt werden? Vor dem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs ab Freitag brachte das Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban auf die Barrikaden. Er droht, alle Entscheidungen bei dem Treffen zu blockieren. Worum es geht:
Ungarns nationalkonservative Regierung steht seit Jahren wegen des Vorgehens gegen Nichtregierungsorganisationen sowie umstrittenen Justizreformen und Eingriffen in die Pressefreiheit am Pranger. Auch gegen Polen hat die EU-Kommission zahlreiche Vertragsverletzungsverfahren eröffnet, weil die dortige rechtsnationale PiS-Regierung gegen die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts vorging und unliebsame Richter in den Ruhestand versetzte. Doch Brüssels Disziplinierungsversuche blieben ohne Erfolg.
EU-Kommission: Drohung mit Stimmrechtsentzug und Geldkürzungen
Im Dezember 2017 startete die Kommission deshalb gegen Polen ein beispielloses Strafverfahren, das bis zum Entzug von Stimmrechten auf EU-Ebene führen kann. Das Europaparlament eröffnete im September 2018 ein solches Verfahren nach Artikel 7 EU-Vertrag auch gegen Ungarn. Doch die Hürden für Sanktionen sind hoch und ein Stimmrechtsentzug gilt in Brüssel als „Atombombe“ im Verhältnis zu Mitgliedstaaten: Die Drohung damit kann demnach zwar der Abschreckung dienen, sollte aber besser nie eingesetzt werden. Die EU-Regierungen unternahmen deshalb keine weiteren Schritte.
Die EU-Kommission versuchte es deshalb mit einem neuen Ansatz: beim Geld. Denn Polen und Ungarn gehören zu den größten Profiteuren der milliardenschweren EU-Fonds zur Regionalförderung. Im Mai 2018 schlug Brüssel vor, EU-Gelder fortan an die Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen. Je nach Stärke des Verstoßes wollte die Behörde die Mittel künftig „aussetzen, verringern oder beschränken“. Gestoppt werden könnte dies demnach nur durch eine qualifizierte Mehrheit im Rat der Mitgliedstaaten, die als schwer zu erreichen gilt.
Schon beim letzten Haushaltsgipfel im Februar zog EU-Ratspräsident Charles Michel dem Kommissionsvorschlag nach Ansicht von Kritikern die Zähne. Sein Plan sieht vor, dass die Mehrheit umgedreht wird und eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten – also mindestens 55 Prozent der EU-Länder mit 65 Prozent der Gesamtbevölkerung – Kürzungen zustimmen muss. Angesichts des sensiblen Themas und auch Zweifeln an der Rechtsstaatlichkeit in anderen Mitgliedstaaten gilt es aber alles andere als sicher, dass eine solche Mehrheit zusammenkommt.
Orbans Veto-Drohung
Orban geht aber auch Michels Vorschlag zu weit. Jeder Versuch, die Frage der Rechtsstaatlichkeit mit den EU-Finanzen zu verknüpfen, werde „unweigerlich zu einer politischen Auseinandersetzung führen“, warnte er vor dem Gipfel. „Wir können unser Veto dagegen einlegen.“ Damit würde Orban das gesamte 1,8 Billionen Euro schwere EU-Finanzpaket einschließlich des Corona-Aufbaufonds blockieren. Die Zustimmung dazu macht er nun auch davon abhängig, dass das Artikel-7-Verfahren gegen sein Land eingestellt wird.
Offiziell hat die Rechtsstaatlichkeit für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) „oberste Priorität“. Allerdings hat sie Anfang Juli klargemacht, dass sie bei den Gipfel-Verhandlungen die umstrittene Frage nicht in den Vordergrund stellen will. „Damit man Fonds mit Rechtsstaatlichkeit (…) verbinden kann, braucht man erstmal Fonds“, sagte die Kanzlerin. Dies stehe bei dem Gipfel „im Fokus“.
Letzte Hoffnung EU-Parlament
Merkels Eins-nach-dem-anderen-Strategie bei der Rechtsstaatlichkeit stößt auch in der eigenen Partei auf Kritik. Der Ko-Vorsitzende der Unionsparteien im Europaparlament, Daniel Caspary (CDU), sieht die „große Gefahr, dass das unter den Tisch fällt und uns später die Druckmittel fehlen“. Er warnte, die nötige Zustimmung des EU-Parlaments zu dem Haushaltspaket sei „kein Automatismus“. Für EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn scheint das Parlament bereits die letzte Hoffnung: „Ich zähle in dieser Frage sehr stark auf das Europäische Parlament. (afp)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.