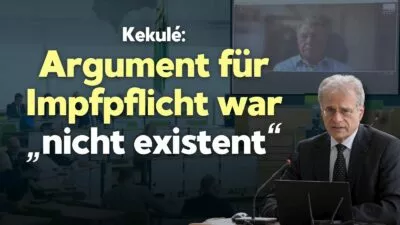Dresden: Geraubte Juwelen sollten Sachsens Anspruch auf den Kaiserthron untermauern
Entsetzen herrscht immer noch in Dresden nach dem Einbruchdiebstahl im Grünen Gewölbe. Ein auf Kunst spezialisierter Versicherungsexperte befürchtet, dass die gestohlenen Diamanten unwiederbringlich verloren sein könnten – durch Umschleifen und Umarbeiten.

Die Polizei hat Fotos von den gestohlenen Schmuckstücken in Dresden veröffentlicht.
Foto: screenshot/Twitter/Polizei Dresden
Hochmoderne, komplexe Sicherheitssysteme – gleichsam per Knopfdruck ausgehebelt: Wie labil der Standard digitalisierter Sicherheit in Deutschland tatsächlich ist und wie weit die Entwicklung im Land noch von ausgefeilten Konzepten künstlicher Intelligenz entfernt ist, zeigte der verheerende Einbruchsdiebstahl vom Montag in Dresden.
Aus dem Grünen Gewölbe in der Dresdner Residenz, in dem die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden knapp 100 Objekte von unschätzbarem künstlerischem und historischem Wert beherbergt, konnten die Kunstdiebe unter anderem einen mit über 770 Diamanten besetzten Degen, einen Bruststern des polnischen „Weißer Adler“-Ordens sowie eine Perlenkette aus heimischen Materialien und eine Epaulette erbeuten. Der gesamte Umfang des Schadens konnte bis dato noch nicht ermittelt werden.
Substanz der Schatzkammer seit dem 18. Jahrhundert erhalten
In der „Welt“ beschreibt Dankwart Guratzsch jedoch die Bedeutung, die das Bauwerk und die darin aufbewahrte Sammlung für das Identitätsgefühl der Stadt und Sachsens insgesamt haben. Die ehemalige Schatzkammer der Wettiner Fürsten wurde seit dem 16. Jahrhundert in einem steinernen Gewölbe errichtet, da dieses den besten Schutz gegen Feuer und ähnliche Katastrophen bot. Wie richtig die damaligen Herrscher mit ihrer Einschätzung lagen, zeigte sich Jahrhunderte später, als sechs von neun Räumen des Grünen Gewölbes – die Kunstschätze waren zu diesem Zeitpunkt in die Festung Königstein ausgelagert – sogar die schweren Bombenangriffe auf die Stadt im Februar 1945 überstanden.
Im Kern geht die heutige Gestalt der Schatzkammern auf den sächsischen Kurfürst Friedrich August der I. zurück, der gleichzeitig auch als König August II. Polen und Litauen regierte und bis heute als „August der Starke“ bekannt ist. Er baute die „Wunderkammer“ in der Zeit von 1723 bis 1729 aus und bestückte sie mit Exponaten, die von anderen europäischen Höfen erworben, aus Materialien der Silber- und Erzbergwerke Sachsens selbst gestaltet oder als Auftragsarbeiten namhafter Künstler gefertigt wurden. August der Starke wollte mit einer so eindrucksvollen Kunst- und Juwelengalerie am eigenen Hofe auch seine Ambitionen auf den Kaiserthron des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation untermauern.
Feierliche Wiedereröffnung 2006 unter beispiellosem Besucheransturm
Ein besonderes Augenmerk galt dabei auch jenen Teilen des Grünen Gewölbes im Parterre des Schlosses, die 1945 zerstört worden waren. Um die Kunstsammlung möglichst originalgetreu wiederherstellen zu können, wurden längst nicht mehr praktizierte Techniken wie die Goldradierung oder Verfahren zur Herstellung und Bemalung von Glas wieder zum Leben erweckt, wie sie zuletzt im 17. und 18. Jahrhundert zum Einsatz gekommen waren.
Die Eintrittskarten für die feierliche Wiedereröffnung am 15. September 2006 waren bereits Monate zuvor vergriffen, viele Interessierte mussten ob des Ansturms trotz Karte vertröstet werden, weil die Säle nur eine maximale Besucherzahl von 120 pro Stunde verkraften.
Die Verantwortlichen in der Museumsleitung waren sich sicher, an alles gedacht zu haben. Nicht nur die maximale Besucherzahl, sondern sogar Beleuchtungsintensität, Staub, Luftfeuchtigkeit und Tageslichteinstrahlung wurde durch ein ausgeklügeltes und vernetztes System moderner Sicherheitstechnik überwacht. Dazu kamen Sicherheitsschleusen, Kameras und Überwachungstechnik. All dies wurde am Montag jedoch mithilfe eines in Brand gesetzten Stromkastens zunichtegemacht. Aus Sicht von Dankwart Guratzsch eine Blamage erster Güte:
„Von künstlicher Intelligenz sind wir noch Äonen entfernt, wenn wir mit modernster Technik nicht einmal imstande sind, simpelste Vorsorgemaßnahmen sicherzustellen, die jahrhundertelang jeden Überfall auf diese Schätze verhindert haben.“
„Clans verfügen über erforderliche Back-Up-Organisationen“
Der auf Kunst spezialisierte Kölner Versicherungsmakler Stephan Zilkens rechnet nun mit dem Schlimmsten. Da die geraubten Stücke unverkäuflich seien, geht er davon aus, dass die entwendeten Diamanten aus ihren Fassungen herausgebrochen, umgeschliffen und an Juweliere in der ganzen Welt verkauft werden. Daraus würden dann Eheringe, Diademe oder Ketten. Andernfalls könnten die Diamanten an ihrem ursprünglichen Schliff wiedererkannt werden.
Zilkens hält es im Gespräch mit „Watson“ für denkbar, dass kriminelle Clans hinter dem Einbruch stecken. Dafür spreche der Präzedenzfall des Raubs der Goldmünze im Berliner Bodemuseum. Zudem verfügten Clans „über die nötigen Back-Up-Organisationen, um solche Arbeiten wie das Umschleifen und Weiterverkaufen mit der nötigen Verschwiegenheit durchzuführen“. Den Sicherheitsverantwortlichen in Dresden wirft er Sparen am falschen Platz und Naivität vor:
„Es scheint so zu sein, dass weder die mechanischen, also Gitter, Fenster, Türen, noch die technischen Schranken, so wie die Alarmanlage, richtig funktioniert haben. Denn auch als der Strom ausfiel, gab es kein Notstromaggregat für die Alarmanlage. Hier wurde konzeptionell offenbar nur auf das Gute im Menschen gesetzt.“
Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times
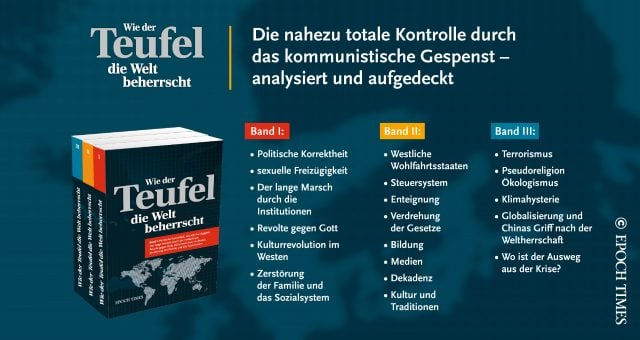
Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“.
Foto: Epoch Times
Hier weitere Informationen und Leseproben.
Das Buch gibt es jetzt auch als Ebook und als Hörbuch
Aktuelle Artikel des Autors
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.