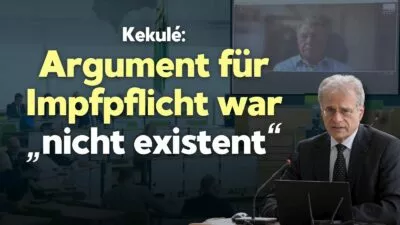In Anbetracht des bevorstehenden Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos herrscht im innerschweizerischen Kanton Zug Unmut. Polizeidirektor Beat Villiger klagt gegenüber dem Portal
„Watson“, dass seine Kantonspolizei mit den Überstunden für den Einsatz umgehen müsse, die aufgrund eines auswärtigen Einsatzes anfallen, die mit dem Kanton nichts zu tun hätten – ohne dass dieser überhaupt die Aussicht darauf habe, die eigenen Kosten wieder hereinzubringen.
Der Unmut kommt nicht von ungefähr. Das Weltwirtschaftsforum ist keine staatliche Veranstaltung, nicht einmal eine einer internationalen Organisation. Vielmehr ist das WEF ein Unternehmen, dessen Vermögen den öffentlich zugänglichen Daten der US-Steuerbehörden zufolge 2017 bei 308 Millionen US-Dollar gelegen hatte – mit steigender Tendenz.
Der Eigenbeitrag zur Sicherheit der Veranstaltung und ihrer Teilnehmer hält sich hingegen in überschaubaren Grenzen: Watson zufolge steuere der Veranstalter selbst nur 2,25 Millionen Franken (ca. 2,09 Mio. Euro) für den Schutz der etwa 3000 Gäste bei.
600 Franken pro Mann und Tag
Villiger bezweifelt, dass sich die Kantone an den Kosten beteiligen sollten, denn zum einen ist der Charakter der Veranstaltung zumindest teilweise privat und zum anderen wäre der WEF selbst in der Lage, die Vorkehrungen zu bezahlen. Erfolgreich hatte er bereits vor einigen Jahren den Antrag durchgebracht, die Entschädigungshöhe für die Kantone aus dem interkantonalen Finanzausgleich zu überprüfen. Ein konkretes Ergebnis habe der Beschluss jedoch nicht nach sich gezogen.
Der Kanton Graubünden, in dem Davos liegt, verfügt selbst nicht einmal über ausreichend Polizeikräfte, um das WEF zu schützen – deshalb gelten auch in anderen Kantonen, die aushelfen, Urlaubssperren und es dürfen keine angefallenen Überstunden kompensiert werden. Dazu gehören unter anderem St. Gallen, Basel-Stadt, Aargau, Solothurn, Schwyz, Luzern oder Zürich.
Exakte Angaben über die Zahl der Beamten, die jeder Kanton stellt, werden nicht gemacht. Pro Mann und Tag gibt es jedoch 600 Franken (ca. 557 Euro) aus dem Finanzausgleich, auf der Basis von Vereinbarungen nach Art jener für Risiko-Fußballspiele.
Sicherheit völkerrechtlich geschützter Personen obliegt dem Staat
Die Kosten für die öffentliche Hand sind nicht unerheblich. Graubünden selbst rechnet mit Kosten von rund neun Millionen Franken. Der Bund steuert 32 Millionen (ca. 29,7 Mio. €) jährlich bei für Luftraumüberwachung, den Transport von Staatsgästen oder die Bewachung von Objekten. Zürich hatte im Vorjahr 20 000 Arbeitsstunden und Zusatzkosten von bis zu 800 000 Franken (ca. 743 000 Euro) im Zusammenhang mit dem WEF 2018 veranschlagt – unter anderem infolge der Anreise ausländischer Staatsgäste über den Flughafen Zürich-Kloten und meist von Linksextremisten organisierte Demonstrationen.
Für Graubünden gibt es zudem auch einen positiven Nebeneffekt für all die Mühen: Wie die Universität St. Gallen errechnete, bringt das WEF dem Kanton 60 Millionen Franken (ca. 55,7 Mio. Euro) zusätzlichen Umsatz. Für den Bund, Graubünden und Davos bedeutet die Veranstaltung am Ende zusätzliche Steuereinnahmen in Höhe von etwa zehn Millionen Franken (ca. 9,28 Mio. €).
Deshalb werden die staatlichen Akteure inklusive des Kantons Graubünden wohl auch Ende 2021, wenn die derzeitige Beteiligungsvereinbarung mit dem WEF ausläuft, die Kirche im Dorf lassen und nicht auf eine drastische Erhöhung des derzeitigen Eigenanteils von 2,25 Mio. Franken bestehen.
„Für die Sicherheit von völkerrechtlich geschützten Personen“, erklärt André Kraske von der Stabsstelle des zuständigen Ausschusses der Bündner Regierung, „ist grundsätzlich der Staat verantwortlich.“