In einer INSA-Umfrage gaben 70 Prozent an, bestimmte Aussagen nicht mehr tätigen zu können – aus Sorge, von anderen kritisiert oder verurteilt zu werden. Doch die freie Meinungsäußerung ist essenziell für eine freiheitliche Gesellschaft. Wie ist es zu dieser Situation gekommen? Hierzu sprach Epoch Times mit Herrn Ralf Schuler.
Herr Schuler begann seine Laufbahn als Journalist 1985 in der ehemaligen DDR. Dort arbeitete er für die Zeitung „Neue Zeit“, später war er für die „Welt“ und „Märkische Allgemeine Zeitung“ tätig. Die letzten elf Jahre arbeitete er bei der „Bild“, in welcher er bis Oktober letzten Jahres die Parlamentsredaktion leitete. Dann jedoch kündigte er. Sein erstes Buch mit dem Titel „Lasst uns Populisten sein“ erschien 2019 und in Kürze erscheint sein zweites Buch „Generation Gleichschritt“, welches in diesem Interview in Bezug genommen wird.
Epoch Times: Herr Schuler, in der DDR konnten Sie nicht studieren. Einerseits haben Sie sich beim Regime unbeliebt gemacht, weil Sie den verlängerten Wehrdienst verweigert haben. Andererseits ist in Ihren internen Bewertungsunterlagen auch zu lesen, dass sie „destruktiv diskutieren“ würden. Was können wir uns darunter vorstellen?
Schuler: Man muss sich in die frühere DDR zurückversetzen, die sich selbst als eine Gesellschaft sah, welche auf wissenschaftlicher Weltanschauung basiert. Also auf dem Marxismus und dem Leninismus. Sie strebte ein hehres Ziel an, nämlich den Aufbau des erweiterten Sozialismus und später des Kommunismus. In diesem sollte es allen gut gehen und es gäbe keine Kapitalisten, die sich den Mehrwert der Produktion aneignen würden. Alle sollten friedlich auf dem gleichen Niveau leben, wobei es keine Egoismen, keinen Wettkampf gegeneinander und natürlich auch keine Ausbeutung gibt. Das Problem ist aber, dass es in einer geschlossenen Diktatur – mit so einem hehren gesellschaftlichen Ziel – nicht statthaft ist, zu diskutieren und aufzuzeigen, dass etwas nicht richtig funktioniert.
In dieser Diskussion kannst du nicht einfach sagen, dass etwas schlecht ist, sondern sollst auch das Positive hervorheben – denn eine solche Diskussion muss ja zu etwas Gutem führen. Grundsätzlich neigen Diktatoren dazu, nicht gerne kritisiert zu werden. Und eine Diskussion, die nur vor Augen führt, dass die Dinge nicht so sind wie vorgespielt – die galt als destruktiv und war abzulehnen. Wenn man also schon Kritik übt, dann muss es immer im konstruktiven Sinne sein, um die gemeinsame Sache voranzubringen.
Eine ähnliche Denkschule gibt es heute auch wieder beim konstruktiven Journalismus. Es soll nicht nur kritisiert, sondern auch das Positive jener Sache hervorgehoben werden. Man ist angehalten, die gesellschaftlichen Ziele weiter voranzubringen. In meinen Augen eine fatale Entwicklung. Journalismus, der gewisse Leitplanken bekommt, wird zum Erfüllungsgehilfen irgendwelcher politischen Ideen. Wenn man sich als Journalist einer bestimmten Idee nahe fühlt, kann man das gerne machen. Aber mit freiem Journalismus hat das nichts zu tun. Und in diesem muss das Kritisieren möglich sein, um Missstände transparent zu machen.
ET: Im Oktober letzten Jahres haben Sie die „Bild“ verlassen. Sie haben das unter anderem damit begründet, dass interne Forderung von einer aktiven Unterstützung der LGBTIQ-Ideologie gesprochen haben. Warum war das ein Problem für Sie?
Schuler: Das hat eine längere Vorgeschichte. Im Mai 2022 hat sich der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner gegen einen Gastbeitrag in der Zeitung die „Welt“ gewandt. In diesem hatten Wissenschaftler, Ärzte und Biologen geschrieben, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt und die öffentlichen Sender aufgefordert, ihre Kinder- und Jugendsendungen nicht mit der Trans-Ideologie zu tränken beziehungsweise diese nicht einfach kritiklos zu übernehmen. Wohlgemerkt war dies ein Gastbeitrag. Ich bin ebenfalls der Ansicht, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt und ich kenne wenige Wissenschaftler, die das anders sehen. Der Vorstandsvorsitzende grätschte da allerdings in bemerkenswerter Manier rein und kanzelte diesen Text ab. Damit hat er im Verlag eine Debatte losgetreten, ob es nun wirklich zwei biologische Geschlechter gibt oder nicht. Und diese Frage blieb offen.
Ich habe mich mit ihm in einer Redaktionssitzung offen darüber ausgetauscht – um nicht zu sagen sogar gestritten. Er sah das anders und verwies darauf, dass es bis vor wenigen Jahren auch den Paragrafen 175 gab, der homosexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Dieser sei schließlich auch gefallen. Das hat aus meiner Sicht nichts damit zu tun, dass es diese beiden biologischen Geschlechter gibt, welche an den Geschlechtsorganen und der Genetik definiert werden.
In der Folgezeit ergaben sich eine ganze Reihe verschiedener Vorgänge, unter anderem ein Rundschreiben an den stellvertretenden Chefredakteur, in welchem stand, dass die Marke „BILD“ fest an der Seite der LGBTIQ-Bewegung stünde. Und am Ende gab es dann noch mich. Möglicherweise ist es mein biografischer Rucksack, den ich aus dem Osten mitschleppe, denn in diesem Aspekt bin ich sehr sensibel. Ich stehe nicht fest an der Seite von irgendwem oder irgendeiner Bewegung. Ich bestreite niemandem das Recht, seine Lebensweise so zu leben, wie er das gerne möchte – das ist völlig klar. Und natürlich würde ich mich auch immer dagegen wenden, wenn irgendjemand diskriminiert wird. Aber ich mache mich nicht zum Gefolgsmann einer kollektiven Bewegung – und das ist der Unterschied. Schließlich hat der Verlag aus symbolischen Gründen immer wieder die Regenbogenflagge aufgezogen. Intern gab es weitere Geschichten, die mich zu dem Schluss gebracht haben, dass wir tatsächlich fest an der Seite dieser politischen Bewegung stehen. Ich finde, das ganze ist eine Lobbybewegung und nicht eine, die Empathie und Toleranz fördert. Es marschieren dahinter auch radikale Kräfte mit, die es sich auf die Fahnen geschrieben haben, das sogenannte heteronormative Weltbild zu zerstören. Als Nächstes kommt die Klimabewegung und da stehe ich dann an der Seite der nächsten Bewegung fest – und das ist nicht mein Ding. Nach alledem stand für mich fest: Ich kündige.
ET: Sie sprechen in Ihrem Buch davon, dass die LGBTIQ-Ideologie auch einer politischen Agenda folgt. Kann es nicht der normale Lauf einer aufgeschlossenen, toleranten Gesellschaft sein, die jetzt zu diesem nächsten Schritt übergeht? Woran machen Sie eine Ideologie und eine politische Agenda fest?
Schuler: Immer dann, wenn es aufhört, eine individuelle Lebensentscheidung zu sein und stattdessen den politischen Raum betritt. Beispielsweise mit der Forderung bestimmter Sprachregelungen – wie dem Gendern oder weiteren Forderungen nach konkreten Gesetzesvorgaben. Das Transsexuellengesetz soll demnächst vom sogenannten Selbstbestimmungsrecht abgelöst werden. Mit diesem wird ein jährlicher Wechsel des Geschlechtes ohne große Hürden beim Meldeamt möglich sein. In diesem Fall ist das schon ganz erstaunlich: Soweit ich die Szene überschaue, wünschen Transsexuelle den Wechsel ihres Geschlechtes, weil sie sich im falschen Körper geboren fühlen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man das jährlich wieder ummodeln muss. Was soll dann also dieser jährliche Geschlechterwechsel? Wie kommt man auf diese Idee? Schon an dieser Gesetzesänderung müsste meiner Meinung nach das Üben von Kritik möglich sein.
Was mich aber extrem stört, ist der aggressive Zug, der in dieser Debatte von der entsprechenden Lobby ausgeht. Der Vortrag einer Biologin an der Berliner Humboldt-Universität wurde mit solchen Störungen begleitet, dass man ihr abgesagt hat. Die international hoch renommierte Autorin Joanne K. Rowling wird bedroht. Es verlieren in Amerika Professoren ihre Stellen, wenn sie Leute mit einem falschen Pronomen anreden. Und das sind so autoritäre Züge, die ich überhaupt nicht vertragen kann. Das hat mit Gleichberechtigung, mit Toleranz überhaupt nichts mehr zu tun, sondern stellt eine aggressive Agenda dar.
Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition finden sich auch weitere Punkte, die eine gesellschaftspolitische Agenda verfolgen. Zum Beispiel die Überprüfung der Leihmutterschaft, welche an ethische Grundfeste rangeht. Es sollen nebst den biologischen Eltern auch rechtliche Eltern installiert werden – als Rechtsinstitut. Diese sogenannte Verantwortungsgemeinschaft, in welcher sich also vier und mehr Menschen zu einer Art Familie zusammenschließen, ist auch eine Veränderung der familiären Zellstruktur der Gesellschaft. Ich betrachte die klassische, heterosexuelle Familie als das Kraftwerk der Gesellschaft, aus der eigentlich alles hervorgeht. Und das halte ich auch für nicht ersetzbar. In solchen Aspekten erkenne ich den Willen, diese Familien in einer bunten Vielfalt zergehen zu lassen, in welcher das von 95 Prozent der Menschen gelebte Lebensmodell quasi atomisiert werden soll. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung hat unlängst gesagt, dass es in einer Gesellschaft der Vielen „kein Normal“ mehr gibt. Das ist offenbar sein Ziel. Und immer, wenn jemand die Gesellschaft umbauen will, nehme ich mir das Recht heraus, da mitreden zu wollen – und gegebenenfalls dagegen zu sein.
ET: An dieser Stelle ein Zitat aus Ihrem Buch, Sie schreiben: „Die staatlich organisierte Überwältigung der Öffentlichkeit in der DDR-Manier kommt heute mit dem gleichen Anspruch auf geschlossene Reihen daher. Wer ausschert, fällt in Ungnade und muss eliminiert oder eingeebnet werden. Das für die Demokratie lebenswichtige kritische Gegenüber ist in der Regenbogen-Welt nicht mehr vorgesehen.“ Sie haben die sozialistischen Mechanismen in der DDR hautnah miterlebt. Ist die LGBTIQ-Agenda Ihrer Meinung nach eine moderne Form der kommunistischen Gleichmacherei?
Schuler: Solche historischen Vergleiche sind immer schwierig. Es ist ja kein geschlossener Staat, es ist kein Machtapparat dahinter. Es ist aber der Anspruch dahinter, dass man quasi selbst betroffen ist. Man selbst ist die Minderheit und deshalb muss die Agenda auch so umgesetzt werden. Alles andere ist auf irgendeine Art und Weise Trans- oder Homophobie oder man wird mit den Nazis vergleichen und mit Hetze überzogen.
Das heißt, es wird bewusst der Anspruch erhoben, dass es darüber keine Debatte geben darf. Und das ist in einer demokratischen Gesellschaft so nicht vorgesehen. In einer solchen gibt es keine Themen, die man nicht anzweifeln oder diskutieren darf. Ich finde, dass man auch über das Transsexuellengesetz oder über die Gendersprache diskutieren muss, weil dieser Stern, den man in die Sprache einführt, bedeutet, dass ich im Prinzip die gesamte Denkweise, die komplette Ideologie, die dahinter steht, auch übernehme. Ich kann ja nicht nur Teile dieser Symbolik übernehmen, sondern wenn ich diesen Stern benutze, schließe ich mich der Gedankenwelt dieser Bewegung an – und deshalb lehne ich das ab.
Ich finde es auch seltsam, dass Medienschaffende sich herausnehmen, eine Sprache zu verwenden, die eine politische Agenda hat und die aber auf der Straße und im normalen Leben eigentlich kein Mensch spricht. Darüber muss man reden. Aber dieser autoritäre Anspruch und die damit einhergehende Kategorisierung derjenigen, die dagegen sind, und diese als Hetzer zu bezeichnen oder ihnen gar irgendwelche Rechte einzuschränken versucht – ich finde, damit ist man auf gewisse Weise in eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit verwickelt. Das ist eine Art und Weise des Mundtot-Machens. Sie haben die INSA-Umfrage zitiert: Am Ende führt es dazu, dass Leute lieber den Mund halten, weil sie Angst haben, sie kriegen eins übergebraten.
ET: In Ihrem Buch legen Sie dar, wie Sozialismus, Kommunismus und auch der Nationalsozialismus einen neuen Bürger, einen neuen Menschen schaffen wollten. Das sehen Sie bei der LGBTIQ-Ideologie ebenso. Warum sehen Sie hierin die Formung eines neuen Menschen und nicht einfach nur die bloße Befreiung einer diskriminierten Minderheit?
Schuler: Mein Ansatz in dem Buch ist eigentlich ein viel größerer, nämlich das Hervorbringen von Konformitätsdruck unter den Bedingungen einer freien Gesellschaft. Wenn man das in der DDR erlebt hat, ist der Druck eines geschlossenen Systems dafür verantwortlich gewesen, dass man lieber die Fahne aus dem Fenster gehangen hat und lieber die gleiche Meinung vertreten oder nichts gesagt hat. Diesen Druck gibt es jetzt nicht mehr. Das war damals ein riesiger Befreiungsschlag, als die DDR zu Ende war. Und ich frage mich, wie in einer Gesellschaft, in der es im Prinzip kaum noch Tabus gibt und wo eigentlich jeder frei sprechen kann, noch solche Gefolgschaften entstehen können.
Ein interessantes Beispiel ist, dass der Bundesverband der Deutschen Industrie die gesamte Fassade seines Firmensitzes in Regenbogenfarben aufgehen lässt und damit tafelt. Firmen unterlegen ihr Signet mit Regenbogenfahnen. Das Stadion von Bayern München bis hin zur Nivea-Handcreme wird in Regenbogenfarben getaucht. Und das finde ich eine ungute Bewegung. In solchen Massenbewegungen, wenn Herren sich kritiklos in Bewegung setzen, ist das schwierig.
Ein Kollege von mir meinte, dass das ganze Land mit Fingern auf solche Leute zeigen müsse, die sich der Impfung verweigern. Das ist eine ganz eigentümliche, für die demokratisch-freiheitliche Ordnung eigentlich gar nicht vorgesehene Verengung des öffentlichen Debattenraums. Wir haben eine ähnliche Geschichte beim Thema Migration, wo es eigentlich nur eine Denkrichtung gibt, nämlich Vielfalt, Offenheit und Buntheit. Und ich bin der Ansicht, dass auch das durchaus zu hinterfragen ist.
ET: Sie haben gerade schon die „Grenze des Sagbaren“ angesprochen. In Ihrem Buch sprechen Sie über die Netzpolitik und Zensur. Wie sehen Sie unsere heutige Informationsfreiheit, insbesondere die in den sozialen Medien?
Schuler: Einerseits sind soziale Medien eine Art Befreiungsschlag. Seit vielen Jahren ist sich die Medienwissenschaft einig, dass es ein leicht nach linksgrün verschobenes Meinungsspektrum in den klassischen Medien gibt – im öffentlichen Rundfunk, aber auch in den meisten Presseredaktionen. Wahrscheinlich, weil in den Kreativbranchen Menschen mit progressivem Weltbild stärker vertreten sind. Da bietet das Ausweichen in die digitalen Medien ein gutes Gegengewicht zu den öffentlichen. Dadurch wird die Vielfalt der Meinung und des Diskurses gestärkt. Ich habe lange Zeit die ehemalige Kanzlerin begleitet. In ihrer Ära kam oft das Thema auf, dass sich im Internet verschiedene Communitys und Milieus zusammenfinden, die ihre eigenen Wahrheiten und Informationen haben und sich in gewisser Hinsicht ein hermetisches Weltbild einrichten. Dieses könne aber von der Realität dann nicht mehr gegriffen werden. Das wurde als Gefahr identifiziert und man hat keine richtige Lösung gefunden, wie man das wieder aufbrechen kann.
Meine Antwort wäre gewesen: Einfach kommunizieren, was das Zeug hält; rausgehen, mit möglichst jedem sprechen und sich nicht zu fein zu sein. Dieser übliche Spruch, „solchen Sachen keine Bühne zu bieten“, führt dazu, dass sich Leute abkapseln und dann nicht mehr erreichbar sind. Es ist ein Kampf gegen vermeintliche Fake News, von denen ich aber finde, dass wir das meiste davon aushalten können. Wenn jemand zum Beispiel sagt, die Erde ist eine Scheibe, dann ist das nicht verboten. Dieser Kampf gegen die Verfestigung von Meinungsmilieus hat dazu geführt, dass man an verschiedener Stelle den „Kampf gegen Hass und Hetze“ aufgenommen hat. Dafür hat man eigentümliche Löschroutinen geschaffen, die meistens von den großen Internetkonzernen per Algorithmus durchgeführt werden. Doch es ist alles sehr intransparent. Es wird auch gern mal präventiv gelöscht – zum Beispiel wenn jemand sagt, dass man Migration begrenzen muss.
Das wird dann als „Hetze gegen Fremde“ diffamiert. So geht das aber nicht und hier sind wir tatsächlich bei einer Art von Zensur angelangt. Der renommierte Anwalt Joachim Steinhöfel hat regelmäßig Erfolge vor Gericht, wo sich Leute gegen ungerechtfertigte Löschungen, Sperrungen et cetera wehren. Das Ganze ist meiner Ansicht nach eine offene Flanke, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss. Niemand redet Bedrohungen, Beleidigungen, Nötigungen oder anderen juristisch greifbaren Geschichten im Netz das Wort. Aber es kann nicht sein, dass aufgrund irgendeiner politischen Agenda im Vorgriff Leute von der Freiheit im Netz ausgeschlossen und dass Meinungen zensiert werden. Das ist aus meiner Sicht ein recht kritischer Trend, der sich da abzeichnet.
ET: Wenn wir auf die gesellschaftliche Entwicklung schauen, in welcher die Konformität in den Vordergrund rücken soll und weniger die Meinungsvielfalt, hat man das Gefühl, man läuft irgendwie rückwärts. Um den Reichstag herum soll – salopp ausgedrückt – ein Burggraben entstehen. Wie lange dauert es denn, bis wir das Mittelalter wieder erreichen?
Schuler: Dass sich der Reichstag mit dem Burggraben umgibt, ist eine nette Metapher, aber ich würde es nicht am baulichen festmachen – das ist nämlich das kleinste Problem. Der Reichstag, so lange auch die Bürger die Kuppel besuchen dürfen, ist aus meiner Sicht nach wie vor ein famoses Bauwerk mit seiner lichtdurchfluteten Transparenz und der Möglichkeit, dort Debatten zu führen. Ein beeindruckendes Monument; diese großen Gänge, die Freiheit des Geistes, die dort eigentlich wohnen sollte. Nachdem es dort verschiedene Vorfälle gegeben hat, werden die Sicherheitsbedenken allerdings auch immer größer. Zum Beispiel hat die AfD offenbar Demonstranten Einlass gewährt, die dann Abgeordnete angequatscht haben. Andererseits gab es aber mehrfache Besetzungen durch Klimaaktivisten, die den Feuerwehralarm ausgelöst und den Reichstag gestürmt haben. Das ist jetzt also nicht auf ein politisches Spektrum begrenzt.
Das Stichwort „Mittelalter“ sehe ich eigentlich eher darin, dass man diese gesellschaftspolitischen Veränderungen relativ starr und autoritär durchzieht. Der mittelalterliche Ständestaat bestand darin, dass man in eine bestimmte gesellschaftliche Schicht hineingeboren war, die man auch nicht verlassen konnte. Und Ähnliches erlebe ich jetzt beispielsweise bei den Quotendiskussionen. Wir hatten in Thüringen den spektakulären Fall, wo ein tadelloser Justizminister entlassen wurde, weil im Kabinett eine Umweltministerin – eine Frau – zurückgetreten war. Und weil sich als Ersatz für die Umweltministerin nur ein Mann fand, musste ein anderer Mann aus dem Kabinett raus und eine Frau wurde an jener Stelle installiert. Das heißt, der Mann hatte den Makel, in seinem Geschlecht geboren worden zu sein. Das ist schon ein Stück weit zurück ins Mittelalter. Das hat der ehemalige Verfassungsrichter Udo Fabio auch angemerkt, dass es Merkmale eines Ständestaates ist, wenn solche äußeren Merkmale darüber entscheiden, ob man ausreichend qualifiziert ist.
Als Ersatz für den Justizminister wurde dann eine schwarze Frau ernannt, eine frühere Polizistin, mit dem Verweis, dass sie die erste schwarze Ministerin sei. Diese junge Frau ist in Saalfeld in der DDR geboren, ist Thüringerin und wird jetzt wieder zur Schwarzen gemacht. Als ob die Hautfarbe irgendwie entscheidend wäre. Das ist auch eine Reduzierung auf ein Merkmal, was wir eigentlich überwunden geglaubt haben.
ET: Schauen wir mal ein wenig auf die Wurzeln. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass auch NGOs durch Steuergelder finanziert werden und eine linksgrüne-politische Agenda durchsetzen. Allerdings sei es Konservativen, insbesondere der AfD, nicht möglich, das gleichermaßen zu tun. Wie ist das in unserer Demokratie möglich, dass da solche Unterschiede herrschen?
Schuler: Die AfD habe ich nur erwähnt, weil diese nach wie vor keine öffentlichen Gelder für ihre parteinahen Stiftungen bekommt. Das Phänomen ist aber tiefgreifend. Bei diesem Verengen des Diskurskorridors greifen verschiedene Effekte ineinander. Da haben wir einmal das blanke Unterdrücken von Meinungen. Bei meinem ersten Buch zum Beispiel: Von der FDP wurde ich zu einer Veranstaltung eingeladen und der dort ansässige Buchhändler weigerte sich, mein Buch für den Büchertisch zu bestellen. Seine Argumentation war, dass das Buch „rechts“ sei. Gelesen hatte er es nicht. Also der Buchhändler hatte eine politische Agenda. Dieter Nuhr beschreibt das auch in seinem Buch ganz gut: Man wird ausgeladen und kriegt keine neuen Verträge. Mir wurden auch Interviews zum Buch abgesagt, weil Leute offensichtlich die Agenda nicht gut fanden. Damit muss ich leben.
Aber worum es mir ging, war tatsächlich das organisatorische Fundament. In den letzten Jahren hat auch die alte Bundesregierung unter Angela Merkel verschiedene Stiftungen ins Leben gerufen, wie solche zur Gleichstellung oder im Zuge der Migrationskrise die Stiftung Demokratie Leben. Letztere wurde in ihren Anfängen mit 40,5 Millionen Euro ausgestattet und hat inzwischen ein Budget von 165 Millionen Euro. Die Stiftung fördert damit etwa 600 Projekte in ganz Deutschland, doch wenn man „Demokratie leben“ ernst meint, müsste es das komplette demokratische Spektrum unterstützen. Gefördert werden aber in der Regel Buntheit und Diversität – also eher linksgrüne Projekte im ganzen Land. So wird mit diesen staatlichen Geldern eine einseitige Landschaft gepflegt, was mit staatlichen Geldern aber eigentlich nicht vorgesehen ist. Das andere ad absurdum ist, dass sich viele von ihnen als NGOs betrachten. Wenn man aber mehrheitlich staatliches Geld bekommt, ist man eigentlich nicht allein, sondern dann ist man eine staatliche Organisation. Das ist schon ein bisschen absurd, aber das merkt offenbar keiner.
ET: Sie sprechen in Ihrem Buch von einer Sprache zur Umprogrammierung im Kopf. Ist Gendern und Political Correctness für Sie eine Art groß angelegter Gehirnwäsche?
Das ist ein bisschen weit gegriffen. Aber es ist natürlich der Versuch – und den kennen wir auch aus autoritären Regimen –, bestimmte Begriffe zu prägen, damit man möglichst nichts anderes denken soll. Beispielsweise wird man angehalten, nicht von Geschlechtsumwandlung, sondern von Geschlechtsangleichung zu reden. Ich halte die Theorie, dass man über die Sprache das Denken umprogrammiert, für sehr zweifelhaft. Aber das ist eine andere Baustelle.
Es gibt also schon den Versuch, ein bestimmtes Denken, eine bestimmte Weltsicht in die Sprache zu gießen und diese dann verpflichtend zu machen – das finde ich anmaßend. Falls ja, müsste man dafür ein demokratisches Mandat haben. Und ich sehe nicht, dass die meisten Leute, die so spezielle Sprachregelungen verwenden, ein solches Mandat haben. In der Gender-Mainstreaming-Richtlinie der Europäischen Union ist allerdings schon vorgesehen, dass sämtliche Gesetzestexte in eine „geschlechtergerechte“ Sprache übertragen werden müssen, was ich auch schon für eine Zumutung halte. Denn im Umkehrschluss sind alle anderen Sprachen dann „Geschlechter-ungerecht“.
ET: Ich greife noch mal gerne den Kern Ihres Buches auf, und zwar die Verengung des Diskurses. Glauben Sie, dass wir wieder zu einem ausgeglichenen öffentlichen Diskurs zurückkehren können? Was wäre dafür nötig?
Schuler: Es gibt aus meiner Sicht einige ganz hoffnungsvolle Ansätze. Beispielsweise erleben wir in letzter Zeit, dass gerade Frauenrechtlerinnen sich dagegen verwahren, dass Transfrauen, die eigentlich Männer sind, in geschützte Räume für Frauen eindringen. Es entstehen also gesellschaftlich durchaus akzeptierte Gegenbewegungen, die sagen: „Lasst uns drüber reden, wir müssen sehen, wo wir Grenzen ziehen.“
Und das hat inzwischen auch die Politik erkannt. Sofern ich weiß, wird im Gesetzgebungsverfahren – beispielsweise über das Selbstbestimmungsrecht – diskutiert, wie man diese „Safe Spaces“ für Frauen erhalten kann. Also, wo verschiedene emanzipatorische Bewegungen gegeneinander stehen – das wird schon ernst genommen. Andere Kritiker jedoch – wie ich – werden gerne als „alte weiße Männer“ abgetan. Damit muss ich leben und das ist auch okay, ich versuche mich dagegen zu wehren. Aber es gibt schon Ansätze. Dieter Nuhr zum Beispiel hat Witze über sein Werk gemacht und wurde mit furchtbaren Attacken überzogen, doch irgendwann hat er dann so viel Solidarität geerntet, dass auch das verstummt ist.
Also es gibt auch wieder Gegenbewegungen und das macht mich am Ende doch wieder hoffnungsvoll.
Das Interview führte Alexander Zwieschowski



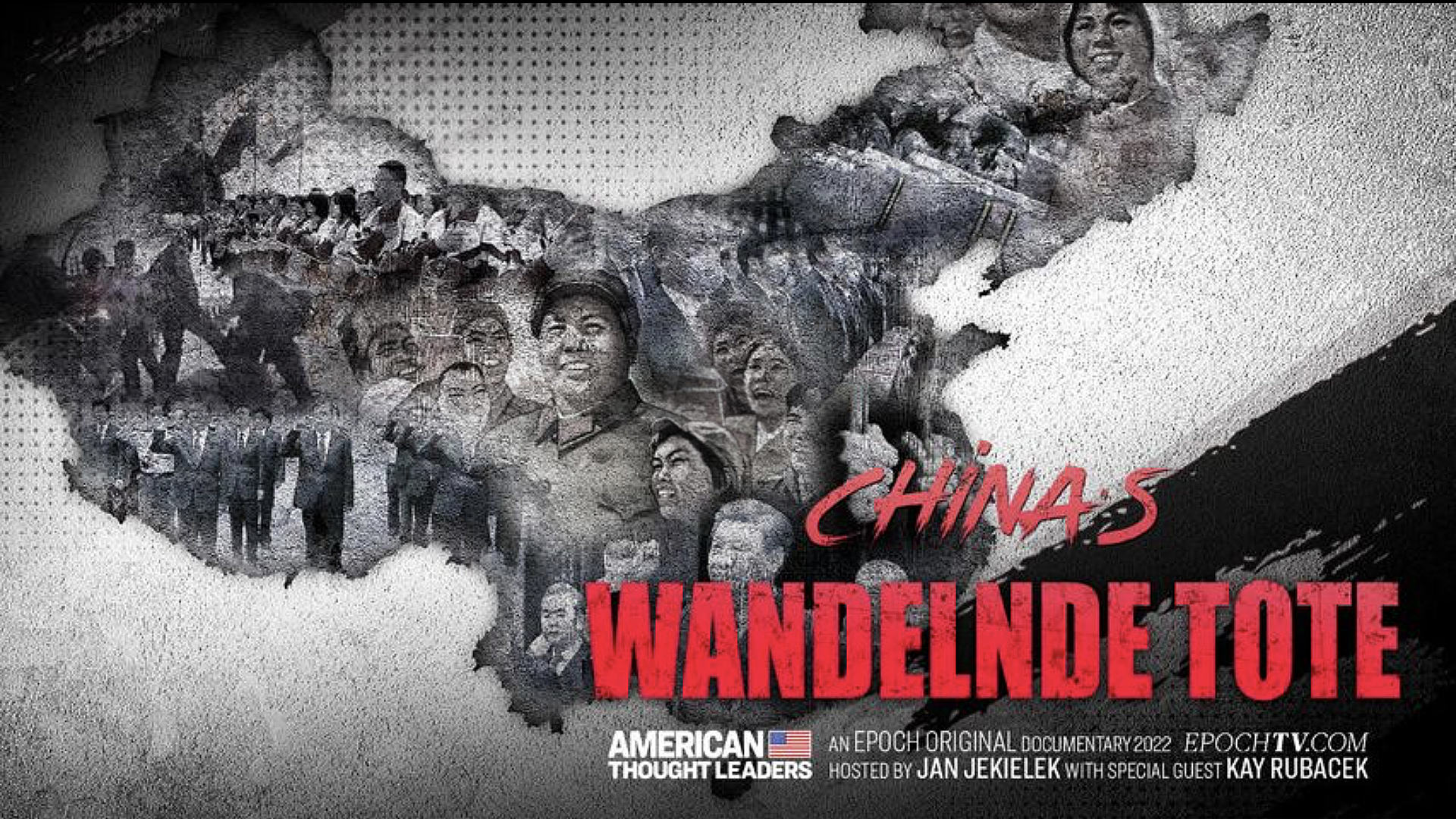









vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion