
Hirnforscher: „In 20 Jahren wird nur noch derjenige arbeiten, der es will“

„In einigen Jahren werden dann 20 Prozent der Menschen nur noch zu Hause sitzen, ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten und in der Virtual-Realiy-Brille leben, weil es keine Jobs mehr gibt, die sie mit ihren Fähigkeiten verrichten könnten.“ Dieses Szenario wird laut Hirnforscher Gerald Hüther die entwickelten Länder in nicht allzu ferner Zukunft ereilen wird, sofern aktuelle Trends weitergehen, wie bisher.
Die Digitalisierung und der Umstand, dass Computer in Zukunft immer mehr menschliche Arbeitskraft ersetzen werden können, sind die eine Sache. Aber der andere Faktor ist das Bildungssystem: Es müsste dringend reformiert werden, so Hüthers Ansicht. Denn in Kindergärten und Schulen werden Menschen derzeit zum Funktionieren herangezogen, anstatt zu selbständigem Denken und kreativer Teilnahme am Leben. Genau diese Lebensfähigkeit müssten wir jetzt vermitteln, damit möglichst viele Menschen auch noch in der Zukunft aktiv leben, anstatt sich in eine virtuelle Welt zurückzuziehen.
Hüther bezieht sich mit seiner Zukunftsprognose auf Studien wie die der Laut einer Oxford-Uni, die voraussagte, dass in nur 25 Jahren 47 Prozent aller Jobs verschwunden sein werden, weil Roboter oder Künstliche Intelligenzen die Arbeit machen werden. Und dies beträfe dann nicht nur Fabrikarbeiter – auch Buchhalter, Ärzte, Juristen, Lehrer, Bürokräfte und sogar Finanzanalysten würden eines Tages durch Maschinen ersetzbar, schreibt „The Economist“.
Das sinnerfüllte Spiel
Die Menschen werden sich selbst eine Arbeit suchen müssen, die ihr Leben mit Sinn erfüllt, so die Meinung des Forschers. Doch wie erzieht man Menschen zur Selbstständigkeit? Hüther plädiert dafür, dass Kinder mehr Freiräume für Spiel und Kreativität bekommen sollten, anstatt schon im Kindergarten mit Mathematik und Fremdsprachen auf das Funktionieren gedrillt zu werden. Was aktuell auf diesem Gebiet geschieht, sieht er als völlig nutzlos oder gar schädlich an.
„Kinder müssen selbstständig und unbekümmert die Welt entdecken und Erzieher müssen Freude und Fragen in ihnen wecken — und sie nicht belehren“, meint Hüther. Denn nur im Spiel würden Menschen ihre Potenziale entfalten. Nur so würde der von Natur aus vorhandene Entdeckungs- und Gestaltungsdrang gefördert. Beschrieben hat Hüther dies ausführlich in seinem Buch: „Rettet das Spiel!“. Gemeint ist damit das Spiel zwischen Menschen – jene fröhliche und sinnfreie Tätigkeit, die als Kommunikation wirkt, Potentiale entfaltet und uns Lebendigkeit erfahren lässt. (Kommerzielle und süchtig-machende Computerspiele sind damit ausdrücklich nicht gemeint.)
Was ist gut für´s Gehirn?
Kinder spielen zu lassen ist jedoch nicht mit einem antiautoritären Laissez-faire zu verwechseln. „In den 1950er- bis 1970er-Jahren gab es diese antiautoritäre Bewegung, bei der Eltern schlichtweg zu faul waren, sich um ihre Kinder zu kümmern und deshalb gesagt haben: ‚Die lernen das von alleine’“, so Hüther. Dies sei auch der Grund, warum die Erziehungskonzepte von Montessori und Waldorf nicht die verdiente Anerkennung erhalten hätten. Waldkindergärten seien jedoch ein gutes Beispiel für frühkindliche Erziehung: „Diese Art von Kindergarten fördert die Lust am Entdecken, weil es ein anregendes Umfeld ist. Zugleich sind die Erzieher oder Betreuer da, um Regeln und Grenzen mit den Kindern auszuhandeln.“
Was Menschlichkeit ausmacht
Eine freundliche Beziehungen zwischen Menschen, die es zu erlernen gilt, liegt dem Hirnforscher prinzipell sehr am Herzen. Schon in seinem vorherigen Buch („Etwas mehr Hirn, bitte!“) beschrieb er deren Auswirkung auf den Einzelnen und die Gesellschaft wie folgt:
„Am Arbeitsplatz, in unseren Bildungseinrichtungen, an unseren Wohnorten, ja oft sogar zu Hause erleben die meisten Menschen, dass sie von anderen zu Objekten gemacht werden. Zu Objekten von Bewertungen, Belehrungen, von Erwartungen und Vorstellungen anderer Personen, oft sogar zu Objekten von Maßnahmen und Anordnungen.
Die meisten haben sich daran gewöhnt und finden es ganz normal. Aber wie kann jemand die in ihm angelegten Potentiale entfalten, sich für irgendetwas interessieren oder gar begeistern, wenn er ständig erleben muss, dass er von anderen und dann ja auch meist auch von sich selbst unter Druck gesetzt wird und sich ständig verbiegen muss, um es den anderen recht zu machen?
Wieso ist es nicht möglich, dass wir einander als Subjekte begegnen, unser Wissen und unsere Erfahrungen, unser Können und unsere Fertigkeiten teilen, einander einladen, ermutigen und inspirieren, über uns selbst hinauszuwachsen statt uns gegenseitig zu frustrieren und unglücklich zu machen? Für unsere Gehirne wäre das allemal besser.“
Siehe auch:
Neurobiologe Gerald Hüther mit „Etwas mehr Hirn, bitte“ zu neuer Beziehungskultur
(rf)



![[Live] Magdeburg: Pressekonferenz mit Polizei und Staatsanwaltschaft](https://images-de.epochtimes.de/uploads/2024/12/THUMB-PK-Magdeburg-400x225.jpg)











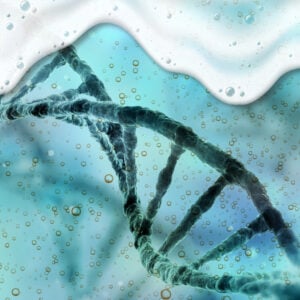












vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion